
Alles für eine Nacht? – Die 100 Kilometer von Biel
Regnet es oder schüttelt der Wind das Wasser aus den Bäumen? Dicht vor meinen Augen webt der Lichtkegel der Stirnlampe ein flirrendes Gespinst aus Tropfen. Das schränkt die Wahrnehmung weiter ein. Nur zweidimensional zeichnet sich vor meinen Füßen der Laufweg ab, Unebenheiten sind schwer zu erkennen. - Laufweg? Laufen? Wo laufe ich? Wann laufe ich und - vor allem - warum laufe ich? Mehrere Fragen, also der Reihe nach: Zweifelsfrei befinde ich mich auf einem Weg. Laut Streckenplan auf der Krone des Hochwasserschutzwalles entlang der Emme. Unstrittig ist auch mein Versuch hier zu laufen. Immer wieder gelingt mir das. Meistenteils stolpere ich jedoch mehr oder weniger unkontrolliert durch die Nacht. Ohne Stirnlampe wäre ich verloren, doch auch ihr fahler Lichtkegel verleiht nicht allen Gefahren ausreichend Kontur: Löcher, Rinnen, Pfützen, glitschige Matschpassagen, kartoffelgroße Steine halb aus dem Untergrund ragend und Wurzeln - immer wieder Wurzeln. Mal trete ich auf ein Hindernis, gerate mehrmals heftig ins Straucheln, mal bricht ein zur Sicherheit extra weit oder vorzeitig aufgesetzter Schritt den Rhythmus. Ich bin auf 100 Kilometer-Kurs in der Nähe von Biel,
 Schweiz, irgendwo im schwarzen Nichts der Kilometer mit einer „6“ davor. Laufen zur Unzeit - morgens zwischen drei und vier. Und dann noch zum „Warum“: „Biel ist toll! Jeder muss mal in Biel gelaufen sein, im Mekka der Ultras. Wer da nicht war, kann nicht mitreden!“. Sagenhaftes steht geschrieben und Fabelhaftes überliefert Mundpropaganda. „Wahnsinnsstimmung! Alles was Beine hat steht an der Strecke und jubelt dir zu!“ - „Wunderbare Lauferlebnisse unter herrlichem Sternenhimmel und der Vollmond leuchtet dir heim!“ - „Überbordende Stimmung in gutgelaunter Läuferschar!“ - „Eine Organisation die ihresgleichen kaum woanders findet!“ Nimmt da jemanden Wunder, wenn sich mein Entschluss hundert Kilometer zu laufen ganz automatisch und unverrückbar mit diesem Ort der Verheißung verband – Biel!
Schweiz, irgendwo im schwarzen Nichts der Kilometer mit einer „6“ davor. Laufen zur Unzeit - morgens zwischen drei und vier. Und dann noch zum „Warum“: „Biel ist toll! Jeder muss mal in Biel gelaufen sein, im Mekka der Ultras. Wer da nicht war, kann nicht mitreden!“. Sagenhaftes steht geschrieben und Fabelhaftes überliefert Mundpropaganda. „Wahnsinnsstimmung! Alles was Beine hat steht an der Strecke und jubelt dir zu!“ - „Wunderbare Lauferlebnisse unter herrlichem Sternenhimmel und der Vollmond leuchtet dir heim!“ - „Überbordende Stimmung in gutgelaunter Läuferschar!“ - „Eine Organisation die ihresgleichen kaum woanders findet!“ Nimmt da jemanden Wunder, wenn sich mein Entschluss hundert Kilometer zu laufen ganz automatisch und unverrückbar mit diesem Ort der Verheißung verband – Biel!
Seit über fünf Stunden renne ich durch die Nacht. Meine Stimmung fällt viertelstündlich tiefer in den Keller und ich unternehme nun den Versuch dir das zu erklären. Aber wie erklärt man Empfindungen, macht verständlich, was man selbst kaum an sich versteht? Vielleicht gibt es mehrerlei Gründe, weshalb ich diesen Lauf in schlechter Erinnerung behalte, vielleicht aber auch nur das eine, alles vergällende Manko. Diesen Laufbericht schreibe ich auch in der Hoffnung darauf eine Antwort zu finden …
Seit über fünf Stunden renne ich durch die Nacht und sehe ... nichts. Ich mache höchstens „visuelle Wahrnehmungen“, die Instinkt und Verstand in Erkenntnisse oder Reaktionen übersetzen. Existent ist nur was im Lichtkegel meiner Stirnlampe, im flackernden Schein anderer Irrlichter um mich herum oder während der eher seltenen Passagen erhellter Zivilisation aufscheint. Nur Promille sonstiger Fluten an Eindrücken lassen sich dem Dunkel entreißen. Mein Geist ist gleichermaßen angespannt und unbeschäftigt. Mentale Automatismen konzentrieren sich auf gleichmäßige Fortbewegung, rechtzeitiges Reagieren bei Unvorhergesehenem und Widerstand - wider fortschreitende Ermüdung, wider wachsende Pein, wider wabernde Unlust. Wenig Äußeres gibt Anlass zum Nachdenken. Wenn ich nächtens schlaflos liege, passiert mir Ähnliches. Ein Strom von Bildern, Erlebnissen und ungelösten Fragen schießt mir durch den Kopf.
Ich erreiche Kilometer 56,1 im Dorf Kirchberg, Verpflegungsstation und Möglichkeit den Wettkampf abzubrechen. Wer nicht mehr kann und muss, oder nicht mehr mag und möchte, steigt hier aus und erscheint in einer eigenen Wertungsliste. Ich lasse diesen Ort der Helligkeit nach Sekunden und prall gefüllt hinter mir. Prall gefüllt ist mein Magen. Der hat jetzt schon mehrmals erlebt, wie man sich als Ballon fühlen muss. Da ich nicht so genau weiß, was die angebotenen Getränke an Kalorien und Mineralien enthalten, leere ich verschiedene Becher nacheinander. Dazu kam einmal, ziemlich am Anfang, ein Stück Banane. Das rutscht ganz gut, hat aber leider eine zu geringe Kohlenhydratkonzentration. Später probierte ich’s mit einem der Energieriegel. Himmel noch eins, der wollte irgendwie gar nicht in den tiefen Schlund einfahren, begann süß-pappig zu verklumpen, drohte schließlich eine untrennbare Verbindung mit meiner Mundschleimhaut einzugehen. Würgend, kauend, mit der Zunge heftigst schiebend und viel zu sparsam Speichel produzierend, brauchte ich sicher bald einen Kilometer, um aus dem Klumpen portionsweise schluckbare Paste zu formen. So verließ ich mich in der Folge lieber dreimal auf das angebotene Gel. Ich mag das Zeug nicht, aber es rutscht einfach am besten und Energie MUSS rein. Nach fester Nahrung kippte ich zusätzlich einen Becher Wasser. Jeder kann sich ausmalen, wie sich drei Becher Flüssigkeit plus feste Energie im Bauch beim Loslaufen anfühlen. Ja, genau, als hätte dir jemand einen Ballon implantiert und bis kurz vorm Bersten aufgepumpt. Aber das ist noch nicht alles. Zwei- oder dreimal ersetzte ich eine der Zutaten durch Cola. Einfach, weil ich den Geschmack des „Blubberlutsch“ nicht mehr ertragen konnte und mir vom Prickeln der leider blähenden Kohlensäure Linderung erhoffte. Das klingt bestimmt jedem, als wollte ich der „100 Km-Leistungsprüfung“ per vorsätzlich verkorkster Magen-Darm-Passage entgehen. Nein, nein, solcherlei Unbotmäßigkeit nimmt mein Verdauungstrakt normalerweise nicht übel und das hässliche Völlegefühl halte ich eben aus. Wenn sich mir dann hinter den Verpflegungsständen mehrmals kapitale Rülpser entrangen, war ich allerdings dankbar, durch die Dunkelheit unerkannt zu entkommen …

Nach diesem wichtigen Kilometer 56,1 fängt er dann an, der „Emmendamm“. Es beginnt mit tosenden aber unsichtbaren Wassern eines Wehres, das mich zur Vorsicht gemahnt. Bloß nicht stolpern und links vom Weg abkommen. Dass es beidseitig des Dammes abwärts geht, kann ich im Schein der Lampe erkennen. Aber nicht wie weit und ob da unten gleich Frau „Emme“ wartet, um mich in ihren Fluten zu ertränken. Jedenfalls bin ich auf der Hut und versuche rechts zu laufen. Ich erinnere mich an einen Beitrag im Forum, in dem eine Läuferin die Wurzeln ankündigte. Es klang reichlich harmlos, zudem schrieb sie nichts von den anderen Fallen und wie rutschig das Geläuf bei Regen werden kann. Von Zeit zu Zeit fluche ich vor mich hin, meist, wenn ich einem Sturz mal wieder knapp entgangen bin. Schmerzhaft bohren sich Steine in meine Fußsohlen, die Gefahr umzuknicken ist latent und zu allem Überfluss werde ich langsamer. Nach ein paar Minuten dieser Tortur bin ich stinksauer. Mit kontrolliertem Laufen hat das nicht mehr viel gemein. Aber natürlich werde ich nicht GEHEN. Verdammt! Ein halbes Jahr Vorbereitung, um mit einer passablen Zeit ins Ziel zu kommen. Da werde ich um der Sicherheit Willen jetzt doch nicht GEHEN! Verdruss macht für Momente zehrender Verzweiflung Platz, wenn ich mir die kleine Ewigkeit vorrechne, die das nun so weiter gehen wird. Mehr als zehn Kilometer misst der verfluchte Dammabschnitt. Ich hole an Tempo heraus, was heraus zu holen ist. Jeden Moment bin ich darauf gefasst „auf die Nase zu fliegen“. Ich möchte stehen bleiben, aber ich kann nicht, darf nicht, hab doch monatelang alles diesem Ziel „Finishen in Biel“ untergeordnet. Weiter, weiter, wird schon gut gehen! Ja geh’n wird’s, aber nicht mehr gut. Mitten auf diesem Drecksdamm verabschiede ich mich von meinem Zeitziel, von der fordernden „Neun“. Einzig meine Frau weiß seit ein paar Tagen, mit welchem Anspruch an mich selbst ich hier angetreten bin. Ihr musste (und wollte) ich es offenbaren, schließlich soll sie den mutmaßlich schönsten Moment meines Läuferlebens mit mir zusammen feiern. „Wenn es einigermaßen läuft, bin ich vor acht Uhr im Ziel. Unter zehn Stunden sollte auf jeden Fall drin sein. Wenn es gut läuft, schließe ich unter 9:30h ab und wenn ein Wunder geschieht auch unter 9h. Aber daran glaube ich selbst nicht!“ - Sie wird da sein! Ich träume mich durch die Nacht, träume mich ins Ziel, träume mich in die Umarmung meiner Frau.
Alle paar hundert Meter glimmt eine der winzigen Funzeln des Veranstalters, meist neben einer der kleinen Orientierungstafeln. Die erhellen natürlich gar nichts, du kannst dich nicht einmal von „Glühwürmchen“ zu „Glühwürmchen“ vorwärts hangeln, dazu stehen sie zu selten. Sie bestätigen einzig noch auf dem rechten Weg zu sein. Und das hab ich bitter nötig. Natürlich gibt der Damm die Richtung zweifelsfrei vor, aber es ist stockfinster und ich bin meist mutterseelenalleine, da erscheinen irrationale Bedenken weniger ungewöhnlich.

Meine Gedanken schweifen zurück, zum Start. Sicher mehr als die Hälfte der Teilnehmer stand dort ohne Lichtquelle! Wie um Himmels Willen wollen die hier durchkommen? Unterstellt, einige von ihnen erhalten später die Lampe von ihrem Fahrradbegleiter. Dann bleiben trotzdem etliche, die ohne Licht diesen halsbrecherischen „Springparcours“ bewältigen müssen. Und hierher dringt kein Lichtstrahl. In meiner Erinnerung seh’ ich sie neben mir stehen, voller Erwartung und Lauflust. Weit über Tausend Läufer, alle auf der Jagd nach der „magischen 100“. Es ist 21:50 Uhr, zehn Minuten noch bis zum Start. Obschon noch immer befangen und voller Zweifel habe ich mir einen Platz in der Spitzengruppe gesucht, maximal hundert Läufer vor mir. Zweifel hin, Befangenheit her: Ich habe eine mörderische Vorbereitung hinter mir, meine Pulswerte sind so gut wie nie und ich gehe nach schulmäßigem Tapering optimal erholt in diesen Wettkampf (Trainingsplan am Ende des Berichts). Also ist exakt hier mein Platz. Wenn ich umsetze, was in mir steckt, dann komme ich unter den ersten 100 Läufern ins Ziel. Dazu bin ich fähig!
Wenn nur die letzten Tage und Stunden aus meinem Gedächtnis zu tilgen wären … In meinem Vorbereitungsprogramm rannte ich von Erfolg zu Erfolg. Welche Brutalität auch immer ich meinem Körper zumutete, er steckte sie weg und belohnte mich herrlichen Wettkampferlebnissen. Ausdauer und mit ihr das Selbstbewusstsein erreichten schwindelnde Höhen, ohne dabei in Überheblichkeit umzuschlagen. Das konnte nicht passieren, dazu war der Respekt vor dem Hunderter viel zu groß. Wenn meine Erwartungen verlässlichen Boden verließen, stellte ich mir einfach vor, wie weit das ist. In meiner Vorstellung setzte ich mich ins Auto und fuhr einhundert Kilometer weit. ‚Für diese irre Distanz brauchst du mit dem Auto schon mehr als eine Stunde’ dachte es in mir und damit war jegliche Gefahr überzuschnappen gebannt. Alles lief super! Aber dann kam das „dämliche“ Tapering. Endlich mal weniger laufen dürfen, einige Ruhetage mehr, Muße für anderes. In der vorletzten Woche halbierte ich das Kilometerpensum, ersetzte Quantität durch Qualität. So was bekommt mir nicht. Kürzere Läufe fordern auch und schon meldet sich der „Oberbedenkenträger“: ‚Wenn dich das schon so sehr anstrengt, wie willst du da 100 km schaffen?’ Dann beging ich auch noch einen wirklich dilettantischen Anfängerfehler. Während des Taperings hängt man ans Ende von Dauerläufen ein paar Steigerungen, etwa fünf in meinem Leistungsbereich. Sie sollen verhindern, dass der Körper infolge verminderter Trainingsreize Ausdauer abbaut. Ja, gut, ok, schon klar. Aber für Udo, sein Kreuz und sein Knie, sind diese Steigerungen pures Gift. Umso mehr, als er nun ein halbes Jahr lang kein höheres Tempo mehr trainiert hat. Nach dem ersten Versuch missachtete ich die Warnsignale und gab’ mir den Unsinn ein paar Tage später noch einmal. Danach fühlte ich mich bei jedem Einlaufen wie ein Wrack. Es ziept in der Leiste, die Beschwerden im Gesäßmuskel - seit Monaten schienen sie besiegt - grüßen unfreundlich und das gereizte, rechte Knie, das all die harten Wochen prächtig kooperierte, hat nun auch die „Faxen dicke“. Ich wurde von Tag zu Tag unsicherer und nervöser.
Jegliche Unruhe ist nun von mir abgefallen. Zehn Meter querab, auf erhöhter Position, mühen sich zwei Moderatoren abwechselnd in Schwyzer Dütsch und Französisch die Stimmung anzuheizen. Verstohlen schaue ich mich um. Die meisten wirken in sich gekehrt, versammelt, konzentriert. Es fehlt der enthusiastische, überschäumende, demonstrativ gutgelaunte Habitus üblicher Startaufstellungen. Viele haben die Distanz bereits erlebt, wissen was die folgenden Stunden von ihnen fordern werden. Grund genug sich in den letzten Minuten ins Schneckenhaus zurück zu ziehen? Und wir Neulinge? Wem geht es wie mir? Während der Cheforganisator von der Empore den „Geist von Biel“ beschwört, den ich bisher noch nicht verspürte, kommt mir mein Vorhaben unwirklich, undurchführbar, sogar vermessen vor. Wie soll das gehen? Einhundert Kilometer laufen und das zu einer Zeit, in der alle Fasern gewohnheitsmäßig eher nach Schlaf und Erholung verlangen? Einhundert Kilometer laufen mit dem immer wieder aufflackernden Schmerz im Rücken. Er wird nach den ersten Kilometern verschwinden! Er wird, weil er MUSS, weil nicht sein kann, was nicht sein darf! „Geist von Biel“ hilf! - Woher ich diese Blessur im Kreuz habe? Ich flachse mal ein bisschen: Nie wieder helfe ich vor wichtigen Wettkämpfen einem Rollstuhlfahrer!

Konnte es körperlich und mental noch schlimmer kommen als in den letzten Tagen des Taperings zu Hause? Es konnte und es kam schlimmer. Donnerstag, die Fahrt nach Biel: Morgen Abend ist es endlich so weit. Ich bin immer noch nervös, aber wenigstens kann ich was tun - Ines und mich nach Biel fahren. Die Schweiz ist erreicht, wir haben uns, über Basel kommend, eine herrliche Strecke durch das Jura ausgesucht. In Moutier überkommen uns Hunger und Lust auf Kaffee und Kuchen. Es ist warm, draußen sitzen Pflicht. Ines schnappt sich in der Konditorei die Kuchenteller und sucht schon mal einen Platz. Wenig später folge ich mit den Kaffeetassen und sehe meine Frau mit einem Rollstuhl ringen! Ein Rollstuhlfahrer ist mit seinem Elektrogefährt vom Bürgersteig abgekommen, hängt mit den Vorderrädern am Randstein fest. Allein schafft sie es natürlich nicht, den schweren Rollstuhl samt Insassen auf das Trottoir zurück zu hieven. Ich springe ihr bei und denke noch ‚pass bloß auf beim Anheben - du bist empfindlich im Kreuz!’ Dann wuchte ich das von Bleiakkus nur so strotzende, zentnerschwere Ding hoch und schon hab ich das Messer im verlängerten Rücken! Erst mal ein erträglicher Allerweltsschmerz. Wird schon nicht so schlimm sein. Am Spätnachmittag gönne ich mir ein kleines Abschlusstraining in Biel. Nach kurzer Zeit lässt der Schmerz im Kreuz nach und ich bin erst einmal beruhigt.
Jakob Etter, Präsident des Organisationskomitees, so der offizielle Titel, ergeht sich immer noch in Selbstbeweihräucherung. Gerade läutet er die „Nacht der Nächte“ ein, verspricht eine Region im läuferischen Ausnahmezustand und ein unvergessliches Erlebnis. Und schon zum zweiten Mal versichert er, wie sehr er sich auf diese Nacht freut. Die Dämmerung schreitet schnell voran. Doch noch ist es hell genug, um den Umschlag des Himmels von Verheißung in Drohung mitzubekommen. Im Westen, an den Hängen oberhalb des Bieler Sees, ballen sich dunkle Wolken. Wird dieser Tag enden, wie er heute Morgen begann?
Freitag: Es regnet! Am frühen Nachmittag lege ich mich im Hotel noch mal zwei Stunden aufs Bett. Jetzt schüttet es wie aus Gießkannen. Mein Stimmungsbarometer steht am absoluten Nullpunkt. Dazu tragen auch die Schmerzen im Rücken bei. Nach jedem Aufstehen brauche ich etliche Schritte, um in Gang zu kommen. Natürlich weiß ich, dass es nach dem Loslaufen verschwinden wird. Aber stell dir mal diese Situation vor! In ein paar Stunden sollst du 100 Kilometer durch die Nacht laufen und kannst nach jedem Sitzen die ersten Schritte nicht mal aufrecht gehen! Bizarrer geht’s nicht mehr. Am liebsten möchte ich diesen Sch…lauf „in die Tonne treten“ und wieder heimfahren. Erst am späten Nachmittag rappelt sich meine gebeutelte Psyche wieder auf. Das Ausstrecken hat dem Rücken gut getan und es hat aufgehört zu regnen! Beim Abendessen, gegen 18:30 Uhr, greifen sogar die ersten Sonnenstrahlen nach dem heute so tristen Biel und versprechen eine trockene Nacht. Meine Zuversicht kehrt zurück, die Laune wird besser, der Jammerlappen klemmt den Schwanz ein und versteckt sich im Keller. Das kann auch das anschließende Parkchaos rund um das Start-/Zielgelände nicht mehr verhindern. Wie lange gibt’s diesen Lauf denn nun schon? Der Organisation ist es jedenfalls vollkommen egal, wo du deinen fahrbaren Untersatz abstellst. Parkplätze sind keine ausgewiesen und jene paar an der Eishalle sind entweder gesperrt oder nach kurzer Zeit hoffnungslos überfüllt. Jeder deponiert sein Auto, wo er hoffentlich niemanden behindert. Alle erfüllt die große Hoffnung: Mehrere hundert Fahrzeuge können die gar nicht abschleppen, also wird die Polizei wegschauen! Und das Allerbeste kommt jetzt: Im per Post zugesandten Umschlag mit Informationen lag eine rote Parkkarte. Weder in den Unterlagen, noch auf der Seite, noch vor Ort war auch nur die winzigste Erklärung verfügbar, wofür die Parkkarte dient. Wir ließen sie im Auto zurück, wie andere auch, um etwaige Gendarmen zu besänftigen … Sehr, sehr mysteriös, was sich der „Geist von Biel“ da ausgedacht hat.
Noch zwei Minuten. Bevor Ines auf der anderen Seite des Starttores in der Zuschauermenge verschwindet, verabschiedet sie mich mit Umarmung, Kuss und guten Wünschen. Mit „Komm gesund zurück!“ passte sie den mir so wichtigen Ritus der besonderen Dimension des Kommenden an. Mich katapultiert dieser „Auftrag“ gedanklich in die bevorstehende Nacht, die ich komplett LAUFEND verbringen will. Und die fetten Lettern der seit Monaten vor dem geistigen Auge prangenden „100“ scheinen noch eine Spur fetter ... Die Sprecher sprechen, Schwyzer Dütsch, Französisch. Keine Ahnung wovon sie sprechen. Ich höre alles, verstehe nichts, bin mit mir befasst. Ist die Ausrüstung komplett, die Vorbereitung abgeschlossen? Schnürsenkel nachgezogen und mit Doppelknoten gesichert? Chip per Klettband am linken Fußknöchel befestigt? Ein Beutel Energiegel als Notreserve in Gesäßtasche der kurzen Lauftight verstaut? Daneben Zwei Papiertaschentücher für Notfälle der anderen Art? Handgelenktasche rechts mit etwas Traubenzucker für Schwächeanfälle und Kochsalz, falls ich übermäßig schwitzen sollte? Stoppuhr links auf Null gestellt? Tabelle mit Laufzeiten am Armband befestigt? Stirnlampe sitzt nicht zu fest und nicht zu locker? Alles erledigt! Zwei Beutel Gel habe ich mir mit ein paar Schlucken Wasser vor einer Viertelstunde verabreicht, um schon auf den ersten Kilometern Energie von außen nachzuschieben. Die Blase ist leer. Wirklich ALLES erledigt! Ich will nun endlich los! Noch 30 Sekunden, dann 20, die letzten 10 beten hunderte Münder mit herunter ... Null, Startschuss!
Sch... Dunkelheit, Sch...damm, Sch...gestolpere, Sch...lauf! Verdammtes Rumgeeiere! Nie wieder! Nie wieder tue ich mir eine solche Strecke in der Nacht an. Aber jetzt bin ich hier und jetzt muss ich hier durch, egal wie. Ich laufe, strauchele, laufe, stolpere, laufe, knicke halb um, laufe, rutsche seitlich weg, laufe, versuche die linke Fahrspur, tappe in eine Pfütze, wechsele zur Mitte, trete auf einen dicken, von Gras verdeckten Stein, probiere die rechte Fahrspur, rette mich über eine Wurzel, laufe, kämpfe, kämpfe ... Selten habe ich Kontakt zu anderen Läufern. Hin und wieder überhole ich einen. Durch meinen Lichtvorhang sehe ich sie meist erst auf den letzten Metern. Manche gehen, andere traben sehr langsam. Das sollte ich auch tun! Aber verdammt - NEIN! Ich hab mich nicht monatelang mit auszehrenden Trainingseinheiten gequält, den kompletten Lebensrhythmus auf diesen 100er ausgerichtet, um hier mit der dritt-, viert- oder fünftbesten aller mir erreichbaren Zeiten zufrieden zu sein. Lauf! Geh das Risiko! Lauf! Irgendwann ist der Mistdamm zu Ende. Wir schieben uns wortlos aneinander vorbei. Zu sehr ist jeder mit sich selbst beschäftigt. Und mit jemandem zu sprechen, den ich nicht mal richtig erkenne, scheint mir widernatürlich. Mundfaul, verdrossen und übellaunig husche ich durch das Dunkel. Mir ist alles egal. Aber was kommt werde ich aushalten und den ganzen Mist anschließend abhaken! Der „Geist von Biel“, die „Nacht der Nächte“, dass ich nicht lache! Inzwischen ist mir zum wiederholten Mal jede Vorstellung von Zeit und Raum abhanden gekommen. Ich kann schon sechs Kilometer Damm hinter mir haben, vielleicht aber auch erst zwei. Mag sein ich eiere schon eine Stunde entlang der Emme. Wenn sich aber jemand auf eine Viertelstunde versteifte, ich nähm’s auch für bare Münze. Bei jedem noch so schwachen Lichtschein über den Bäumen keimt Hoffnung auf: Hab ich’s gleich geschafft? Kann ich mich gleich wieder auf einem ebenen Stück Feldweg oder Asphalt erholen? Wie mag es den anderen ergehen?

Die anderen, das sind Tessa, Conni, Stefan und Frett. Kurz nach 21 Uhr trafen Ines und ich sie auf der Tribüne im Eisstadion. Für mehr als ein paar oberflächliche Gespräche und das obligatorische LA-Fori-Foto reichte die Zeit nicht. Immerhin konnte ich meine „Rollstuhlgeschichte“ an den Mann respektive die Frau bringen. Auch wenn ich die beiden Frauen in meiner fahrigen Vor-Wettkampf-Stimmung zunächst gar nicht wahrgenommen hab. Die beiden werden’s mir nachsehen - hoffe ich. Die anderen, das ist auch Bernd aus meinem Heimatort, der mich in der Startliste aufspürte und an-mailte. Und wie schlägt sich Moni? Wir haben uns in den letzten Tagen noch per Mail über Erwartungen und Ziele ausgetauscht. Ich hoffe sie kommen hier alle ohne Blessuren durch.
Mein Gefühl will mir einreden wie eine „lahme Schnecke“ über diesen Damm zu „rutschen“. Das ist Unsinn, ich weiß. Aber deutlich langsamer geworden bin ich schon. Die nach dem Lauf verfügbaren Zwischenzeiten bestätigen: Kurz vor dem Damm war ich etwa mit 5:20 min/km unterwegs, auf dem Damm dann mit mehr als 6 min/km. Plötzlich renne ich über festen, ebenen Untergrund und nähere mich einem Lichtschein, über dem sich eine Brücke abzeichnet. Ein paar Sekunden später stehe ich trinkend unter der Brücke vor dem reichhaltigen Büffet des nächsten Versorgungspostens. Weiter, ich muss weiter! Meine Hoffnung, ich könnte das Schlimmste überstanden haben, kann ich mir noch ein paar Minuten bewahren. Jenseits der Brücke ist der Dammweg sogar asphaltiert. Ich schöpfe neuen Mut und nehme wieder mehr Fahrt auf. Dann ist der Asphalt zu Ende und die Schuhe knirschen auf festem, feinem Schotter. Doch auch der trägt mich nur noch ein paar hundert Meter und alles geht weiter wie zuvor - unter meinen Füßen und in mir drin. Dabei begann der Lauf recht verheißungsvoll vor mehr als fünf Stunden ...
Nach der Startgeraden biegt die Meute Richtung Stadtmitte ab. Biels Außenbezirke dienen mir zum Warmlaufen. Schon hier steht eine lockere Reihe von Zuschauern. Wie es scheint bin ich dem „Geist von Biel“ dicht auf den Fersen. Schon nach den ersten Schritten merke ich, wie sich meine Rückenschmerzen langsam in Nichts auflösen. Meine Laune erfährt einen gewaltigen Schub, Kinderhände zum Abklatschen kommen mir da gerade recht. Hier wurde akribisch vorgesorgt: Jeder auch nur ansatzweise stolperverdächtige Kanaldeckel erhielt einen warnenden Rand aus roter Leuchtfarbe. Ebensolche Zickzack- oder Wellenlinien lenken Läufers Aufmerksamkeit auf vergleichsweise harmlose Absätzchen oder Risse im Asphalt. Ein Streckenposten fungiert als „Wellenbrecher“, teilt den dichten Läuferstrom auf einer Verkehrsinsel stehend. Vom Start weg laufe ich verhalten, will mich von nichts und niemand mitreißen lassen. Meine Lauftabelle basiert auf Vielfachen von 5:20 min/km. Der erste Kilometer bildet sich mit 5:01 Minuten auf der Uhr ab. Zu schnell, aber nicht dramatisch. Ein klein wenig reduziere ich mein Tempo. Kilometer 2 stoppe ich mit 10:05 Minuten, Kilometer drei mit etwas über 15. Ich spüre die Geschwindigkeit nicht, fühle mich frisch und ausgeruht. Außer dem üblichen „Anfangsmuckern“ schweigt mein Knie und der untere Rücken erzählt fröhlich wie gut ihm Laufen bekommt und dass ich so schnell nicht wieder damit aufhören soll. Da kann ich ihn beruhigen, die nächsten neun (?), zehn (?) Stunden werde ich für sein Wohlbefinden arbeiten ...
Schon nach 3,5 Kilometern das erste Trinkangebot. In der Bewegung schnappe ich mir einen Becher mit farbigem Inhalt und runter damit! Kurz danach kommt mir meine Unkonzentriertheit in den Sinn: Eigentlich wollte ich am ersten Stand WASSER trinken, um die zwei Gelportionen von vorhin noch weiter zu verdünnen. Sei’s drum, es wird die Rehydrierung nur unwesentlich beeinflussen. In der abendlichen Kühle schwitze ich ohnehin nur wenig. Meine Startposition war gut gewählt, Überholmanöver sind nicht nötig und von hinten schiebt sich höchstens zentimeterweise jemand vorbei. Wer hier mitrennt hat jahrelange Wettkampferfahrung und keine Schwierigkeiten sich richtig zu positionieren. Meine Uhr kann ich problemlos ohne Stirnlicht ablesen, obwohl die Nacht sich inzwischen vollkommen über Biels Straßen senkte. Lichtreklamen, Straßenbeleuchtung und Schaufenster erhellen die Route. Herrliches, sorgenfreies, unangestrengtes Laufen, die zur Stadtmitte hin immer dichter werdenden Zuschauerspaliere und das abendliche Flair einer sympathischen Stadt stecken an. Noch ein paar Kinderhände abgeklatscht ... Wenn sich in mir trotzdem hartnäckig ein nicht unerheblicher Rest Zurückhaltung festkrallt, so liegt das an der Ungewissheit. Gedanken an die folgenden Stunden formen sich unwillkürlich, lassen sich nicht unterdrücken. Was werden sie mir abverlangen? Werde ich überhaupt durchhalten? Völlig ausgepumpt aufgeben zu müssen halte ich durchaus für eine realistische Möglichkeit. Bis jetzt musste ich noch nie aufgeben, nicht mal einen Schritt vor Schwäche gehen. Aber was heißt das schon? Hab ich denn je versucht in einem solchen Tempo über 100 Kilometer erfolgreich zu sein? Nein, es ist nicht übertrieben, den Ursprung solchen Zauderns redlich und salopp so zu formulieren: Ich hab’ noch immer „Schiss“ vor dieser Entfernung! Also geht’s mir gut, aber ich schnappe vor lauter Lauflust beileibe nicht über.

Die meisten meiner Mitläufer traben gleichfalls mit unbewegten Gesichtern vor sich hin. Nur wenige reagieren auf die vielen in die Laufstrecke ragenden Kinderarme. Vielleicht genießen sie auch nur den jetzt kräftigen Beifall in der dicht gefüllten City. Einem hochgewachsenen Schlanken vermiese ich diese Stimmung ein wenig. Offensichtlich verkennt er meine Absicht eine Kurve hart an der Bordsteigkante zu nehmen, wollte auf diesem Weg wohl gerade an mir vorbei. Seine heftige Beschwerde quittiere ich mit dem lapidaren „Sorry, aber hinten habe ich keine Augen!“, worauf er sich nachmaulend und mit kleinem Zwischenspurt absetzt. War mein Verhalten möglicherweise falsch? Ich durchdenke die Situation noch einmal, komme aber zum selben Ergebnis. Mein Laufweg war eigentlich mit Logik vorhersehbar, einen Haken hab ich nicht geschlagen und in so einer Situation versucht man nicht zu überholen.
Ein Schild am rechten Straßenrand kündigt eine Zusatzschleife für die Marathonis an. Die sollen geradeaus, wir müssen nach rechts. Blöderweise weiß ich in diesem Moment nicht, dass die Nachtmarathonis erst eine halbe Stunde nach uns starten und außerdem ein Schild „Nachtmarathon“ auf dem Rücken tragen. So gibt mir die Streckentrennung minutenlang Grund zum Grübeln: Wo bitte geht’s hier geradeaus? Die Zuschauer bilden eine ununterbrochene Mauer. ‚Bin ich auf dem richtigen Weg oder renne ich vielleicht hinter Marathonis her?’ Das 5 Km-Schild befreit mich dann endgültig von der Sorge die Laufdistanz unfreiwillig über 100 Kilometer ausgedehnt zu haben ...
Zwei nebeneinander her joggende Soldaten in kompletter Tarnbekleidung verfolge ich schon seit einiger Zeit mit den Augen. Laufschuhe anstelle schwerer Militärstiefel bilden das einzige Zugeständnis an ihren heute außergewöhnlichen „Dienst“. Sogar ihre Kopfbedeckung (unmilitärisch: Mütze), ein rotes Barett, tragen die beiden Polen. Die weiß-roten Nationalkennzeichen am Oberarm und Sprachfetzen, die an mein Ohr dringen, enthüllen ihre Nationalität. Der rechte Soldat ist äußerst mitteilsam, redet mit wenig Unterbrechung auf seinen Nachbarn ein. Mein Blick fällt auf seinen Nacken. Vom klatschnassen Haaransatz tropft es immer wieder in den olivfarbenen Kragenstoff. Selbst Soldat und mit ähnlicher Montur jahrzehntelang vertraut, kann ich mir den bereits jetzt „reichen Fluss ihrer Körpersäfte“ unter dem Uniformstoff gut ausmalen ... Um wenig in der Welt möchte ich mit den beiden jetzt tauschen.

Hinter uns liegt die Innenstadt mit ihrem verschwenderischen Lichterglanz und massiert angetretenen Zuschauerheeren. Noch spenden Straßenlaternen ausreichend Licht, um jede Unebenheit der Straße vorzeitig auszumachen. Eine lockere Kette von Interessierten harrt applaudierend auf Bürgersteigen und Grundstücken aus. Eine Brücke steuert die ersten von insgesamt 650 zu überwindenden Höhenmetern bei. Klar horchst du zu Beginn einer solchen Unternehmung besonders intensiv in dich hinein. Was ich spüre beruhigt, meine Beine nehmen das vergleichsweise harmlose „Brücklein“ kaum wahr. Es verbindet die Ufer des breiten Nidau-Büren-Kanales, in dem die Wasser der „kastrierten“ Aare die letzten Kilometer bis zum Bieler See überwinden. Ohne wirklich zu wissen wo ich bin und ohne das Gewässer in dunkler Tiefe überhaupt zu sehen, kann es sich nur um jenen Kanal handeln, an dessen Ufer ich gestern meinen letzten Schmuse-Trainingslauf absolvierte. In nachmittäglicher Hitze und Sonnenschein hätte ich ihn gerne ausgedehnt, zu verlockend schien mir die Aussicht am grünen Spazierufer stundenlang schauend unterwegs zu sein. Aber die „magische 100“ ließ mich dann nach 20 Minuten doch umdrehen. Jene „100“, die seit Monaten überall geschrieben stand, ganz gleich wohin ich schaute ...
Die Brücke war der Auftakt, das Signal zur primären „Bergprüfung“. Kaum habe ich das andere Ufer erreicht, gewinnt die Straße einige Prozente Steigung. Vom Studium des Streckenprofils erinnere ich etwa achtzig, neunzig Meter Höhe auf knapp einem Kilometer Distanz. Wie erwartet nehme ich das Hindernis mit Elan und Leichtigkeit, bei reduziertem Tempo. Abschnittsweise und erstmalig wird’s hier im locker besiedelten Stadtteil Bellmund richtig dunkel. Kein Grund Batteriestrom zu verschwenden, was sollte auf glattem Asphalt schon den Weg verlegen? Sporadisch Zuschauer auch in diesem Wohnbezirk. Da wird einer neben mir im Halbdunkel erkannt. Von den auf Schwyzer Dütsch gewechselten Zurufen verstehe ich wenig, die Glückwunschformeln sind aber ohne Anstrengung zu interpretieren. Ein junges Mädel lässt es sich nicht nehmen den Vater (?), Bekannten (?), Nachbarn (?) ein Stück bergauf zu begleiten. Bald 50 Meter reicht ihre Puste, dann kapituliert sie heftig atmend und schickt meinen Mitläufer mit ein paar „erstickenden“ Worten in die Nacht. Kurz vor der Kuppe ein weiterer Verpflegungspunkt: Zwei Becher, einmal dunkelbraun-Pfirsich und einmal rot mit einem Geschmack, der heftig an mannshohe, heftig brodelnde Retorten erinnert, füllen sekundenschnell meinen Magen. Weiter: Noch ein Stück aufwärts, ein kürzeres ebenerdig und rasch auf abschüssige Bahn. Auf Gefällestücke habe ich mich gedanklich besonders eingestellt: Ich werde sie so schnell wie möglich und sinnvoll laufen! Nicht verhalten, um Füße zu schonen und Kräfte zu regenerieren. Runterwärts verzögern verlangt vom Laufapparat zusätzliche, arhythmische Bremsarbeit und gibt ihm unnötige Stöße mit. Von flott und weiter ausgreifend gelaufenen Gefällestrecken zeigten sich meine „Hax’n“ dagegen weitgehend unbeeindruckt. Also lasse ich es laufen. Bisweilen liegt das Geläuf vollkommen im Dunkeln. ‚Soll ich das Risiko eingehen hier ohne Stirnlicht runter zu rasen?’ Glatter Asphalt, nach wie vor, immer wieder Straßenbeleuchtung in bewohnter Gegend. ‚Das geht, hier liegt schon nix auf der Straße!’ Und so konzentriere ich mich vollkommen auf meinen Laufrhythmus und sause in einem „Affenzahn“ durch die halbwegs ausgeleuchtete Welt ...

Die Blase drückt ein wenig, ihr gefällt die Schussfahrt nicht. ‚Nein, jetzt noch nicht, vielleicht vergeht das wieder.’ Auf fast zwei Kilometern hole ich einen Teil der im Anstieg verlorenen Zeit wieder auf. Wie viel? Keine Ahnung. Am Fuß des Hügels oder kurz danach muss die 10er-Kilometertafel stehen, die mir jedoch entgeht. Denn nun ist es wirklich so weit, ich bin wahrhaft eingetaucht in die „Nacht der Nächte“, in die Welt der Schemen. Der Himmel ist bedeckt. Keine Sterne, kein Mond, da oben ist nichts, woran Augen sich entlang hangeln könnten. Mein Sehvermögen hat sich flugs an die Finsternis gewöhnt. So genügt einstweilen das Restlicht weit entfernter Lichtpunkte, um meinen Mitläufern ein Dasein als Schatten zu sichern. Noch immer Straße unter den Füßen, reicht mir das zur Orientierung. Leises Getrappel bleibt das einzige Geräusch. Mit dem Tag hat sich auch der Wind verabschiedet. Kein Läufer weint ihm eine Träne nach. Ich fühle mich exakt richtig angezogen - nicht zu warm und nicht zu kalt. Also ideale Laufbedingungen!? Ja, schon, aber da ist ein merkwürdiger Umstand, den ich zu wenig kenne: In der Dunkelheit fällt es mir sehr schwer Geschwindigkeit und Stil meines Laufes einzuschätzen. Bisher hätte ich der felsenfesten Überzeugung das Wort geredet, Geschwindigkeitskontrolle sei reine Gefühlssache. Tempoempfinden entspränge ausschließlich Signalen die Lunge, Kreislauf und Muskeln senden. Auf diesen ersten stockfinsteren, von keinen anderen äußeren Einflüssen gestörten Kilometern wird mir sonnenklar, wie bedeutend der Anteil des Sehens dabei ist, das langsame Vorbeiziehen der Umgebung, der scheinbar schneller von den eigenen Schritten überwundene Boden. Bin ich zu schnell oder zu langsam? Oder etwa genau richtig? Die Kilometertafeln stehen jetzt nur noch alle 5 km. Eine Antwort wird dauern.
Ein paar Mal schaue ich mich um. Ich versuche etwas von meiner Umgebung zu sehen. Etwas an das ich mich später erinnern kann, das meinen Kopf beschäftigt, ihn zum Nachdenken bringt, zum Werten oder einfach nur zum Ignorieren und Woanders-hin-schauen. Ja, einmal frage ich mich sogar, wovon ich denn nächste Woche im Laufbericht erzählen soll? Denn ich sehe wirklich nichts. Die Welt um mich her besteht aus Schatten, Schemen, vereinzelten, entfernten, dementsprechend kleinen Lichtquellen. Ich bewege mich in Abstufungen von Schwarz, zwischen 99 und 100 Prozent Dunkelheit. Abgesehen von der frischen Luft, könnte man mich genauso gut auf ein Laufband in einem nahezu lichtisolierten Raum stellen. Das Gefühl des Alleinseins wird richtig aufdringlich. Auch die Schattengestalten in meiner Nähe ändern daran nichts. Ich laufe, laufe, laufe ... Laufe ich wirklich? Welchen Sinn hat das? Hat es einen? Läufer rennen durch Wüsten, traben in der Arktis, eine wollte jüngst sogar einen Marathon in der Raumstation laufen. Meine Aufgabe ist jetzt ein paar Stunden weitgehend ohne Sicht und Eindrücke über Schweizer Erde zu wetzen. Das ist doch ok. Ist das ok? Ich meine für MICH ok? Eine Antwort gebe ich nicht. Noch nicht. Denn diese Fragen existieren dort in meinem Kopf nur als diffuse Mischung von Gefühlen, nicht als bewusste Gedanken. Erst später, als alles vorbei ist, in den Tagen danach und hier beim Schreiben gelingt es mir zu formulieren, was mich dort düster beeindruckte. Eine Antwort gebe ich nicht, noch ist nicht genügend Nachtzeit in Sätze gefasst ...
Huschende Lichtspiele voraus, etwas steht dort vorne im Weg. „Etwas“ entpuppt sich als Streckenposten, der die kleine Läufergruppe, in der ich mich bewege, mittels Taschenlampe oder Ähnlichem von der Straße winkt. Fortan rubbelt Beton unter meinen Füßen. Nicht ganz so glatt, aber immer noch kein Grund eigenes Licht zu investieren - glaube ich. Die Auffassung hat nur Sekunden Bestand und scheitert hörbar: Ein unwillkürlicher, halblauter Schreckensruf übertönt durch große Pfützen platschende Füße. Drei Meter vor mir entsteht ein Lichtkegel und auch meine Hand fliegt in Richtung Stirn. Die starken Regengüsse des Vormittags konnten auf diesem Feldweg nicht völlig abfließen. Ein Slalomlauf mit gelegentlichen Weitsprungeinlagen beginnt. Zeitweise ist das Betonsträßchen auch vertrauenerweckend trocken. Kaum haben wir uns dem Dunkel ausgeliefert, verlangt bekanntes Platschen neuerlich nach Licht. So geht das eine Weile, weiß der Himmel wie lange. Übergangslos endet Beton, beginnt fester, griffiger, grobkörniger Sand oder Schotter. Natürlich nutze ich die festen Fahrspuren und nicht die etwas unebenere, häufig grasbewachsene Mitte. Die ersten Wasserlöcher überraschen noch, zwingen zu flinken Ausweichmanövern und in Wegesmitte, meinem intelligenteren (oder erfahreneren?) Vordermann an den Fersen klebend. Der ständige Blick vor die eigenen Füße ist nervig und anstrengend. Diese Phase dehnt sich scheinbar endlos. Vorher war die Welt dunkel, aber schier grenzenlos. Jetzt reduziert sie sich auf den bleichen, unruhigen Schein meiner Stirnlampe. Irgendwie fühle ich mich in eine andere Dimension versetzt, in einen winzigen Raum, in dem nur ich existiere, in dem die Zeit steht - steht oder quälend langsam vergeht. Genau genommen renne ich hinter diesem winzigen, lichten Universum her, versuche es zu betreten und doch entzieht es sich mir. Beschleunige ich meine Schritte, bewegt es sich gleichfalls schneller. Kommt mein Lauf ins Stocken, wartet es auf mich. Verrückt! Verrückt und auf eine milde Art deprimierend.
Da ziehen noch andere Universen auf ihrer Bahn - vor mir, hinter mir. Von Zeit zu Zeit schiebt sich mein Raum-Zeit-Kontinuum an einem anderen vorbei. Dabei verschmelzen die Lichtsphären zu einer, formieren sich zur hell erleuchteten Blase über schotterigem, sandigem, grasigem, pfützigem, überwiegend ebenem Bodenschluss. Meine Psyche war immer recht stabil, aber DAS hier legt sich bleischwer auf’s Gemüt. Das Erlebnis „Biel“ beginnt sich bereits hier, in der Ebene zwischen Bellmund und Aarberg, in zwei Bereiche zu spalten. Da ist das rein Sportliche: Langes Laufen, Energie fließt reichlich; die Ampeln der orthopädischen Abteilung signalisieren „Grün“, alles in Ordnung, kein Grund zur Sorge. D’rumherum leben die Umstände: Egal wie gut sie objektiv betrachtet auch sein mögen, die alles umfangende Schwärze raubt mir jeglichen Spaß.
Innere Dämonen hinfort, es geht ums Laufen: Die 15 Kilometer müssen längst abgehakt sein. Das Schild habe ich wieder nicht entdeckt. Kein Wunder, wenn man ständig vor die eigenen Füße starrt und versucht anderen nicht ins Gehege zu kommen. Mein Tempo dürfte ungefähr dem angepeilten entsprechen. Sagt mein Laufgefühl, das sich inzwischen ein wenig an die neuen Bedingungen gewöhnt hat. Die Blase meldet sich inzwischen mit mehr Nachdruck. Eine Weile diskutiert der Leidensfähige mit dem Wohlfühljogger; Thema: Ehrgeizige Zielzeiten, die von überflüssigen, halbminütigen Pinkelpausen um der Entspannung Willen auf’s Spiel gesetzt werden. Lichtschein kündigt bewohnte Bezirke an, die Füße trappeln plötzlich wieder auf Asphalt. Das Weichei ergreift die Initiative und lenkt mich an Wegesrand. ‚Auch gut, seh’ ich wenigstens wo ich steh’ und was ich nässe.’ Der Ehrgeizling lässt ihn aufatmend gewähren, immerhin hängt der Typ an denselben Organen ... Weiter!

Eine Weile trabe ich durch mehr oder weniger verlassene Straßen. Keine Ahnung, wo ich bin. Aarberg müsste das sein oder Lyss? Die Streckenkarte verschwimmt in meiner Erinnerung. Egal, Hauptsache HELL! Die Lampe ist längst gelöscht, die Augen sammeln Impressionen. Dankbar registriere ich die Bilder, Mitläufer in voller Lebensgröße, Straßenzüge, jedes klatschende Händepaar. Im Nu fällt alles Bedrückende von mir ab. Hinter der nächsten Linkskurve beginnt ein kurzer, nichtsdestoweniger höchst entzückender Sightseeing-Trip. Ich laufe auf das „Maul“ einer altehrwürdigen, mit durchgehendem Satteldach gedeckten Brücke aus dem Jahre 1557 zu und ... bin verschluckt. Auf Holzbohlen, umgeben von dicken, dunklen Balken geht es über die kleine Aare. Mein Kopf ist noch mit der prächtigen Brücke beschäftigt, da tragen mich die Füße auf einen der bezauberndsten, mittelalterlich geprägten Plätze, die man sich vorstellen kann. Er ist voller Menschen. Eine Minderheit bildet applaudierende Spaliere, die meisten sitzen in Straßenlokalen und genießen das vormitternächtliche Spektakulum bei einem Gefäß voll Irgendwas. Aber die Leute sind Nebensache! Zarte, schmeichelnde Beleuchtung verleiht pittoresken Fassaden eine geradezu märchenhafte Wirkung. Jeden der schmalen Fenstersimse schmückt ein Blumenkasten, mit kleinwüchsigen, rot blühenden
 Pflanzen. Wunderschön ist diese Ansicht, ein Postkartenmotiv und auf kaum zu deutende Weise unwirklich. Als hätte jemand Hausansichten aus einem Märchenbuch ins Riesenhafte vergrößert, auf Holz geklebt und als Bühnenbild beidseits des Platzes errichtet. Auch an den Blick auf Modellbahnanlagen werde ich erinnert: Du blickst von schräg oben auf einen exakt der Wirklichkeit und mit Liebe fürs Detail nachgebildeten Platz und bist dir doch in jedem Moment der Miniatur bewusst ... Stand mein Mund für Sekunden offen? Höchstens zweihundert Meter Kulisse, dann nehmen uns moderne Straßenzüge auf, der Zauber verfliegt.
Pflanzen. Wunderschön ist diese Ansicht, ein Postkartenmotiv und auf kaum zu deutende Weise unwirklich. Als hätte jemand Hausansichten aus einem Märchenbuch ins Riesenhafte vergrößert, auf Holz geklebt und als Bühnenbild beidseits des Platzes errichtet. Auch an den Blick auf Modellbahnanlagen werde ich erinnert: Du blickst von schräg oben auf einen exakt der Wirklichkeit und mit Liebe fürs Detail nachgebildeten Platz und bist dir doch in jedem Moment der Miniatur bewusst ... Stand mein Mund für Sekunden offen? Höchstens zweihundert Meter Kulisse, dann nehmen uns moderne Straßenzüge auf, der Zauber verfliegt.
20 km sind geschafft, zwischen Aarberg und Lyss fangen meine Augen die erste Kilometertafel der Dunkelzeit ein. Jetzt weiß ich, wonach zu suchen ist: Ein schwaches Blinklicht markiert die in Augenhöhe angebrachten Schilder. Meine Laufzeit entspricht dem Plan, liegt sogar leicht darunter. ‚Na also, passt doch!’ Hat das sein müssen? Bisher wurde doch kaum ein Wort gesprochen und der da muss ausgerechnet in meiner Nähe und gut verständlich anmerken, dass „man“ die Strecke schon ganz nett in den Beinen spürt. Ja, stimmt, geht mir genauso. Du kannst 1.000 Wochenkilometer trainieren und wirst trotzdem nach den ersten zwanzig im Wettkampf was spüren! Einen ähnlichen Satz bete ich mir nun innerlich vor. Das beruhigt den Hasenfuß wieder. Eben fragte er mich, wie er denn noch 80 Kilometer laufen solle, wenn schon 20 anstrengen. Ganz zerstreuen kann ich seine Ängste nicht, eine Spur Hoffnungslosigkeit bleibt.
Diese Dunkelphase war kurz, vielleicht drei Kilometer, dann erreichen wir den nächsten größeren Ort: Lyss. Auch hier gibt’s reichlich Publikum zu zwischenzeitlich mitternächtlicher Stunde. Da warten sie: 100, 200, 300? Schwer zu schätzen, wie viele Fahrradbegleiter sich in dieser Kurve ausgangs Lyss aufreihen. Pro Läufer konnten maximal zwei Lizenzen erworben werden. Ihr für €12,- erworbenes „Permit“ tragen die Radler als Schriftzug „Coach“ auf dem Rücken. Anfänglich war die Route zu voll, später zu schmal, Begleiter sind daher erst jetzt zugelassen. Obwohl für mich niemand bereit steht, profitiere ich zunächst vom rollenden Zuwachs. Die vielen Fahrradscheinwerfer erlauben über weite Strecken ohne eigenes Licht zu laufen. Die folgenden Kilometer werden auch mehrmals von Dörfern gesäumt. „Grossaffoltern“ steht da am Ortseingang, oder auch „Vorimholz“. So hält sich meine Stimmung erst einmal. Zudem fordern die Beine nun mehr Aufmerksamkeit, es geht seit Lyss mehr oder weniger bergauf. Ich suche und finde das richtige Tempo: Langsam genug, um meine Ausdauerdepots zu schonen, schnell genug, um nicht unnötig Zeit zu verlieren.

Da will uns jemand „heimleuchten“. An einem Ortsende strahlt mir ein greller Scheinwerfer entgegen. Ich laufe auf merklich ansteigendem Rad- oder Fußweg. Die Blendung wächst mit jedem Meter, so bekomme ich nur im Augenwinkel die Aufschrift eines Hinweisschildes mit: „Velos nach links / 100 km Biel rechts“. Bevor ich über die Bedeutung der Mitteilung ins Grübeln verfallen kann, bin ich fast unterm Flutlichtmast angekommen. Ein Offizieller rast auf mich zu und ehe ich recht realisiere was hier abgeht, drückt er mir auch schon einen Kontrollstempel auf die Startnummer. Verblüffung und Kontrollakt lassen mich kurz stoppen - sofort geht’s weiter, nach rechts und wieder hinein in die Dunkelheit...
Sie haben mich wieder voll im Griff, bedingen sich gegenseitig, äußere und innere Finsternis. Ich weiß es jetzt, bin aber zum Glück nicht in der Lage es mir einzugestehen: Laufen in der Dunkelheit missfällt mir. Es geht keine Freude davon aus. Dächte ich das so klar, müsste ich schlussfolgernd fragen: Welchen Sinn hat es zu laufen, so weit zu laufen, wenn das Wichtigste fehlt - der Spaß? Da Empfindungen einstweilen keine klaren Gedanken spinnen, kann mich die hässliche, demotivierende Antwort nicht aus dem Konzept bringen. Hartnäckig hält sich der Verdacht zu langsam unterwegs zu sein. Sinnlos daher im 5-km-Rhythmus Uhr und Tabelle am Handgelenk abzugleichen. Ich schaue einfach nicht mehr hin. Tempo verschärfen kommt jedoch auch nicht in Frage. Häufig, zu häufig, denke ich voraus und jedes Mal erscheint es mir unwahrscheinlicher überhaupt ans Ziel zu kommen: Noch 75, noch 70, noch 65 Kilometer wie soll ich das schaffen? Eine schwache Welle von Verzweiflung umspült jede dieser Überlegungen. Und das steht in harschem Kontrast zur sportlichen Realität. Ich laufe mit konstanter Geschwindigkeit, ohne jedes körperliche Problem. Die Spannung in den Beinen ist geringer, als sie das nach 30, 35 Kilometern sein könnte.
Auch den neuen Tag berechne ich schon mal: Gegen 4:30 Uhr erwarte ich einen ersten schwachen Schimmer aus Richtung Osten. ‚Noch vier (!) Stunden’ lautet das Resultat der Gleichung und geht leider seinerseits mit negativem Vorzeichen in meine Stimmungslage ein. Mit allem hätte ich gerechnet, nur nicht damit, dass mir Laufen in der Dunkelheit dermaßen zusetzt. Dabei habe ich einen 40 Kilometer-Trainingslauf zu nachtschlafener Zeit hinter mir. Aber da regnete es Hunde und Katzen, war kalt, windig, mit einem Wort „eklig“. Außerdem nutzte ich mir bekannte Wege, auf denen Erinnerung Teile des Sehvermögens ersetzt. Es war eine zutiefst widerwärtige Erfahrung. Auf die Idee, einen Teil meiner Abneigung der Dunkelheit zuzuschreiben, kam ich nicht.
Die Route wechselt mehrmals von asphaltiertem auf fest geschotterten Untergrund. Meist registriere ich Feldwege erst, wenn mir die etwas wackeligere Laufweise bewusst wird. Spätestens dann schalte ich die Stirnlampe wieder ein. Es ist eines dieser modernen, leichten LED-Modelle. Die Brenndauer soll zig Stunden betragen. Trotzdem schone ich die Batterien immer wieder, will jedes Risiko eliminieren, irgendwann ohne Licht dazustehen. Mein Ohr hat sich an das gleichmäßige Scharren der Füße auf Schotter gewöhnt, einziges Geräusch weit und breit. Dann mischt sich von hinten ein weiteres, zunächst leises Knirschen schnell gesetzter Schritte unter meines. Es verstärkt sich, kommt rasch näher, schwillt an, ist kurz hinter mir, der Schein zweier Leuchten hat mich schon überholt. Dann sind sie vorbei: Ein Radler
 und der erste Marathonläufer. Der Mann auf dem Velo ist als Begleiter des Führenden gekennzeichnet und auf dem Rücken
des Läufers lese ich „Nachtmarathon“. Mein Hirn hat für Sekunden wieder was zu tun: Wieso hatte ich bis jetzt keinen Läufer mit dem Marathonhinweis vor mir? Weder am noch in der dichten Menge nach dem Start ist mir eine solche Kennzeichnung aufgefallen. Natürlich ist die Antwort einfach, der Marathonstart erfolgte eine halbe Stunde nach uns. Aber das weiß ich nicht und komm’ auch nicht drauf. Vielleicht, weil mir wieder einmal jeder Zeit-Raum-Bezug fehlt. Seit einer laaaangen Weile geht es ohne Berührung menschlicher Behausungen stockdunkel dahin. Wozu auf die Uhr schauen? Nicht mal auf fünf Kilometer genau könnte ich im Moment meine Position angeben. Wann hab ich das letzte Mal ein Streckenschild gesehen? Es ist mir egal. Ich stampfe gleichmäßig und erstaunlich unangestrengt vor mich hin. Ist die Leichtigkeit ein Hinweis auf zu geringes Tempo? Innere Sensoren verneinen, trotzdem misstraut ihnen die demotivierte Fraktion: ‚Ist doch wurscht, die neun Stunden sind sowieso nicht machbar, selbst zehn werden schwer.’
und der erste Marathonläufer. Der Mann auf dem Velo ist als Begleiter des Führenden gekennzeichnet und auf dem Rücken
des Läufers lese ich „Nachtmarathon“. Mein Hirn hat für Sekunden wieder was zu tun: Wieso hatte ich bis jetzt keinen Läufer mit dem Marathonhinweis vor mir? Weder am noch in der dichten Menge nach dem Start ist mir eine solche Kennzeichnung aufgefallen. Natürlich ist die Antwort einfach, der Marathonstart erfolgte eine halbe Stunde nach uns. Aber das weiß ich nicht und komm’ auch nicht drauf. Vielleicht, weil mir wieder einmal jeder Zeit-Raum-Bezug fehlt. Seit einer laaaangen Weile geht es ohne Berührung menschlicher Behausungen stockdunkel dahin. Wozu auf die Uhr schauen? Nicht mal auf fünf Kilometer genau könnte ich im Moment meine Position angeben. Wann hab ich das letzte Mal ein Streckenschild gesehen? Es ist mir egal. Ich stampfe gleichmäßig und erstaunlich unangestrengt vor mich hin. Ist die Leichtigkeit ein Hinweis auf zu geringes Tempo? Innere Sensoren verneinen, trotzdem misstraut ihnen die demotivierte Fraktion: ‚Ist doch wurscht, die neun Stunden sind sowieso nicht machbar, selbst zehn werden schwer.’
Dass es ein Marathoni war, der an mir vorbei zischte, baut mich hingegen ein wenig auf. Der „darf“ das, noch dazu der Führende. Tatsächlich wurde und werde ich auf diesem Streckenteil kaum eingeholt, laufe allerdings auch selbst selten zu Vorderleuten auf. Die „Sache“ gerät immer mehr zum einsamen Solotrip. Zu dieser Zeit treffen mich auch die ersten harmlosen Spritzer von oben. So fein, dass ich mich eine Weile frage, ob das wirklich Regentropfen sein können. Merkwürdig - wie stellt man fest, kann sicher sein, geradeaus zu laufen, ohne wirklich etwas von der Umgebung zu sehen? Oberramsern kann jetzt nicht mehr weit sein. Es geht seit Ewigkeiten ohne merkliche Steigung und beinahe geradeaus dahin. Also volle Übereinstimmung mit meiner Erinnerung der Streckenkarte vor Oberramsern. Als es dann so weit ist, bin ich doch überrascht von der Unvermitteltheit mit der die Station aus dem Dunkel wächst. Überrascht auch von der Unbelebtheit: Hier ist das Marathonziel, ein Verpflegungspunkt, zusätzlich besteht für Zuschauer die Möglichkeit den Ort per Bus zu erreichen und doch herrscht „tote Hose“. Zum ersten Mal eine Matte der Zeitmessung, zweigeteilt, Marathonis rechts, 100 km Biel links und „pfüüüt“ bin ich registriert.
Offiziell: 38,5 km, 3:23:24, Position 135, noch mehr als 4 Minuten unter dem Schnitt für Sub9h.
Ich trage einen Champion Chip am Fuß - einen schwarz lackierten. Mein eigener liegt im Hotel, gelb und überflüssig. Ein weiterer, schwer zu durchschauender Geniestreich des „Geistes von Biel“. Ein Großteil der hier angetretenen Läufer dürfte einen dieser in vielen Wettkämpfen eingesetzten Chips besitzen. Warum ist es dann nötig hier mit Leihchip zu laufen? Hat es mit Einnahmen zu tun?

Mit prallem Wasserbauch und gehäuften Rülpsern geht’s hinter dem Verpflegungspunkt scharf rechts und merklich abschüssig dahin. Vom Ort selbst, wenn er denn aus mehr als einer Handvoll Häuser besteht, hab’ ich nichts gesehen. War das „Pfüüüt“ ein Wecksignal? Ein bisschen mehr im „Diesseits“ zurück, fangen meine Augen endlich mal wieder eine Tafel ein - „40 km“. Die Marathondistanz ist in ein paar Minuten abgehakt und ich fühle noch immer wenig Abnutzung in allen „Systemen“. Ein wenig Optimismus gießt das über dem Zweifler aus, hält ihn erst mal in Schach. Mein Gedächtnis widersetzt sich hartnäckig: Von den folgenden 15.000 Metern blieben nur ein paar Erinnerungsfetzen …
… Es regnete mehrfach, in seiner Intensität auf- und abschwellend, allerdings nur einmal wirklich heftig und nässend.
… Begegnungen mit Radbegleitern: Zwei Läufer nebeneinander, die radelnden Damen plaudernd und unachtsam dahinter; der Weg ist schmal, hat in der Mitte eine Grasnarbe; Udo holt auf und zerschneidet die Formation zunächst per Licht, dann mit Schritten in zwei Teile - Ich trabe auf Asphaltstraße mit unterbrochenem Mittelstreifen leicht bergan, Stirnlampe gelöscht; Veloscheinwerfer von weiter hinten irrlichtern um meine Füße, irritieren, vermitteln den Eindruck zu schwanken. Irgendwie schaffe ich es eine Weile nicht parallel zur Mittenmarkierung zu laufen, bewege mich in Schlangenlinien. Seltsam, seltsam! - Velos rasen manchmal mit Affenzahn von hinten nach vorne, dann wieder von vorne nach hinten. Sind die unausgelastet oder suchen sie ihr zu hütendes Schäfchen? - Mäßig steiler Anstieg auf Feldweg, vor mir ein heftig pedalierender Radler; komme immer näher; just als ich ihn erreiche, kapituliert er mit ersterbendem Stöhnlaut vor der Steigung, verliert ein wenig die Kontrolle über sein Gefährt, rollt mir vor die Füße und steigt ab. Einen Schritt weiter und er hätte mich flach gelegt. - Wieder eine leichte Steigung, hundert Meter voraus ein zunächst schwacher, wackelnder, in alle Richtungen schwenkender Lichtschein. Dann wendet das Velo und leuchtet mir entgegen. Grelles Licht blendet meine in der Dunkelheit weit geöffneten Pupillen. Nicht genug damit, rollt er jetzt auf mich zu. Ich weiche dicht an den rechten Wegrand aus, will nicht überfahren werden. Er wird mich doch sehen? Die Blendung wird schärfer und er kommt näher, auf meiner Seite. Ja sieht der mich denn nicht? Als ich mich schon auf ein wildes Ausweichmanöver vorbereite, bremst er im letzten Moment und ich laufe grummelnd um ihn herum.
… Da schält sie sich aus der Dunkelheit die mit gelinder Spannung erwartete 50-Kilometer-Tafel. Jetzt will ich es wissen und richte den Lichtkegel auf die Anzeige meiner Uhr: 04:27:xx entziffere ich und bin baff erstaunt - um „Lichtjahre“ schneller als ich befürchtete!?? Dass nun heftiger Kampfgeist, Stoßrichtung Sub9h, aufwallte, wäre zu hoch gegriffen. Die irrationalen „Versagensängste“ der letzten Stunden verstaue ich allerdings in der untersten Schublade. Zum ersten Mal scheint es mir „wahrscheinlich“, den Lauf LAUFEND zu beenden. Zum ersten Mal wage ich auch an eine Zeit unter 10 Stunden wenigstens zu „glauben“. Zwar hallt in mir weiter das Wort eines Biel-Finishers von der „gefühlten Mitte“ erst bei 65 km wider. Doch noch immer laufe ich reichlich unbeeindruckt von mittlerweile erklecklicher Distanz. Selbstverständlich spüren die Beine den absolvierten Fünfziger, sind jedoch weit von ihren Grenzen entfernt.
… Ein paar kleinere Dörfer lagen am Weg. Einige Hände fanden sich immer für dankbar registrierten Beifall. Am liebsten möchte man sich bei jedem Einzelnen für sein Ausharren bedanken. Gleichwohl blieb die Publikumsresonanz eklatant hinter den ach so heiß geschürten Erwartungen zurück.

… Der nächtliche Austragungsmodus verbirgt nicht nur eine - vermutlich - idyllische Landschaft, auch von einigen alten, offenbar gut erhaltenen und wunderschönen Bauernhöfen erhasche ich im blassen, entstellenden Licht nur schemenhafte Eindrücke. Verflixte Dunkelheit!
Schließlich erreiche ich den Ort Kirchberg und die 55 km-Tafel, laufe durch vollkommen ausgestorben wirkende Straßen - nicht erstaunlich für 3 Uhr nachts. Dass ich es dennoch mit einem kleinen Fragezeichen registriere, rührt von überschwänglichen Schilderungen, die mir das Bild begeistert feiernder Dorfgemeinschaften in der „Nacht der Nächte“ eingaben. Nach ein paar Minuten nähere ich mich einer großen „Lichtblase“. Nach so vielen dunklen, einsamen Stunden blendet die Helligkeit des Versorgungspunktes. Er kommt mir reichlich bevölkert und erfüllt von Geschäftigkeit vor. Objektiv hätte dieser Eindruck angesichts der wenigen Menschen, die tatsächlich durch meine Erinnerung geistern, kaum Bestand. Zum zweiten Mal werde ich gemessen und registriert - „pfüüüt“!
Offiziell: 56,1 km, 5:00:13, Platz 91, noch knapp 3 Minuten unter dem Schnitt für die Zielzeit 9h.
Während ich vermittels Einfüllens mehrerer Becher flüssiger und einer Tube schmierig-süßer Energie ein weiteres Mal zum Ballon mutiere, schaue ich mich suchend um: Wo ist die Klamottendeponie? Es mag an meiner Begriffsstutzigkeit zu vorgerückter Laufstunde gelegen haben, jedenfalls hätte ich mich erkundigen müssen. Und so bin ich gottfroh, schon lange vor Kirchberg den sicher mit enormem Zeitverlust zu bezahlenden Kleiderwechsel ausgeschlossen zu haben. Obwohl es mehr oder weniger vor sich hin nieselt, triefe ich auch nicht annähernd in einer Weise, mich der Umziehtortur zu unterwerfen. Dazu muss man den durch langes Laufen inflexiblen Körper verrenken, biegen, Gliedmaßen an schon schmerzenden Gelenken knicken und zusätzlich Gleichgewicht bewahren. Jeder Langstreckler weiß, wie unendlich weit unten Schnürsenkel nach über 50 Kilometer sind … Nein danke! - Ich bin gestärkt, gebläht, nehme wieder Fahrt auf, verlasse den Lichtkreis und versuche mich am härtesten Streckenteil - dem Emmendamm …
Alles Gemeine, Elende, auch Schmerzhafte des Laufsports ertragen - ich kann das. Wozu trainiere ich schließlich immer wieder im Grenzbereich? Der Drecksdamm wird mich nicht brechen! Mit reduzierter Geschwindigkeit kämpfe ich mich voran. „65 Kilometer“ - lange kann es nun nicht mehr dauern. Nicht ein „Konkurrent“, der mich auf den insgesamt zwölf Kilometern entlang der Emme überholt hätte. Ein paar Hurtige ließen mich wohl hinter sich, aber der Schriftzug „Stafette“, hieß mich sie nicht weiter beachten. Nur einmal, wohl beim Ersten, zeugte Verwunderung eine Frage: „Wieso überholen die erst jetzt?“ Aber die Frage war schon nicht mehr klar ausformuliert. Und zum Nachdenken habe ich nach Stunden wortlosen Brütens entweder zu wenig Geisteskraft oder es fehlt die Lust - wahrscheinlich beides. Gut, dass ich mich an die Frage nicht verschwende, denn die Lösung hätte meinen Rest-IQ nach 60 Kilometer Dunkellauf überfordert: Die Staffelläufer gingen erst eine Stunde nach uns, um 23 Uhr, auf die Strecke.
Halt aus - es kann nicht mehr lange dauern. Da vorne, über den Bäumen, ein Lichtschein! Isses dort geschafft? Nein! Das ist nur ein taghell erleuchtetes Werksgelände, hinter dessen Zaun gewaltige Dampfwolken gen Himmel steigen. Immerhin ein paar Meter fester Weg, einige Sekunden sehen, Eindrücke. Irgendwo dort oben in den Wipfeln zwitschert eine Amsel. Das gefällt mir immer, unbeschadet sonstiger öder Umstände. ‚Bleibt der Weg nun fest und sicher?’ Der Gedanke hat mehr von Flehen, als Fragen. Aus diesem Satz könnte man ein Gebet entwickeln, zumindest sollte er in die Fürbitten sonntäglicher Andachten aufgenommen werden. Für einfach gestrickte Christenmenschen gehört es zu den unerklärlichen Eigenheiten des Allmächtigen, solcherart Wünsche zu ignorieren. Jedenfalls sehe ich mich recht schnell wieder dem Emme-Stolperpfad ausgeliefert. Steinchen und Dreck spüre ich in meinen Schuhen. Sch… drauf! Bin doch schon tausend Mal folgenlos und über weite Strecken so gelaufen. Kein Grund zur Sorge und keiner zum Halten! Weiter, weiter, weiter! Sogar zum Schimpfen geht mir am Ende die Lust aus. Stur vorwärts, stur alles ertragen, stur laufen, alles Scheußliche geht vorbei, alles!
Dann ist die Erlösung da und ich mag dem Frieden erst nicht trauen. Links sehe ich zuweilen das Flussbett und trabe auf fest geschottertem Untergrund dahin. Nicht zu früh frohlocken. Ein paar Fahrradbegleiter haben sich hierher vorgewagt. Sie durften den Emmendamm nicht befahren, müssen folglich vom anderen, dem „schönen“ Ende kommen. Nein, so klar denke ich dort nicht. Es ist eher eine „gefühlte Erkenntnis“. Klingt das nach Blödsinn? Je länger ich unterwegs war, je härter sich die Bedingungen gebärdeten, umso mehr wich jede Art von Denken dem Empfinden. Es kommt mir vor, als lenkte die Psyche alle Geisteskraft auf das eine Ziel: Aus- und Durchhalten! Denken stört da nur.
Immer mehr Radler tummeln sich auf dem Weg, er bleibt breit und fest. Letztlich führt er mich zu einer weiteren Tränke und nach dem Laben über eine Brücke. Geschafft! Am Ziel bin ich längst nicht, und doch fühlt es sich ein bisschen so an. Irgendwo auf dem Schlussabschnitt des Dammes hat sich noch einmal eine Ladung Dreck in meinen rechten Schuh geschmuggelt. Zwischen Schaft und einer Stelle unterhalb des äußeren Knöchels reibt es heftig. Ich muss das korrigieren
 und halte Ausschau nach Licht und einem kniehohen Podest oder Ähnlichem. Ein gut ausgeleuchteter Treppenaufgang holt mich schließlich fünf, sechs Meter neben die Straße. Ich stelle den Fuß hoch und realisiere erfreut, dass Bücken gar
nicht so weh tut. In fliehender Hast löse ich den Doppelknoten des Schuhs, streife ihn ab, leere ihn aus … Zur Sicherheit rolle ich noch den Strumpf über die Ferse und beseitige, was sich dort eingenistet hat. Wieder anziehen, Senkel straff ziehen, Doppelknoten und dasselbe Spiel auf der linken Seite - wenn ich denn schon mal dabei bin. Wie lange dauert so ein Manöver? Zwei Minuten? Drei? Keine Ahnung. Ein bisschen fürchte ich nach der Kauerhaltung und der langen Pause den Wiederanlauf-Schmerz. Grundlos, wie ich angenehm überrascht registriere. Wie kann das sein, nach über 65 Kilometern und einer Stunde Gestolper, so locker - ja wirklich „locker“ - ins Rennen zurückzukehren? Das hilft und stärkt die Zuversicht - es geht aufwärts: Ich werde ankommen!
und halte Ausschau nach Licht und einem kniehohen Podest oder Ähnlichem. Ein gut ausgeleuchteter Treppenaufgang holt mich schließlich fünf, sechs Meter neben die Straße. Ich stelle den Fuß hoch und realisiere erfreut, dass Bücken gar
nicht so weh tut. In fliehender Hast löse ich den Doppelknoten des Schuhs, streife ihn ab, leere ihn aus … Zur Sicherheit rolle ich noch den Strumpf über die Ferse und beseitige, was sich dort eingenistet hat. Wieder anziehen, Senkel straff ziehen, Doppelknoten und dasselbe Spiel auf der linken Seite - wenn ich denn schon mal dabei bin. Wie lange dauert so ein Manöver? Zwei Minuten? Drei? Keine Ahnung. Ein bisschen fürchte ich nach der Kauerhaltung und der langen Pause den Wiederanlauf-Schmerz. Grundlos, wie ich angenehm überrascht registriere. Wie kann das sein, nach über 65 Kilometern und einer Stunde Gestolper, so locker - ja wirklich „locker“ - ins Rennen zurückzukehren? Das hilft und stärkt die Zuversicht - es geht aufwärts: Ich werde ankommen!
Es geht aufwärts, die Straße hat jetzt Steigung. Nicht viel, aber stetig. Ich nehme sie wahr, sie stört mich nicht. Weder was die Kräfte angeht, noch mental. Devise: Alles ist besser als dieser elende Damm … Keinerlei Probleme das Tempo zu halten. Es geht aufwärts, die Kilometertafel mit der „70“ erlebe ich als einen der wichtigsten, positiven Momente dieses Laufs: Nur noch dreißig Kilometer! Weniger als ein langer Lauf. Ich weiß die Laufzeit nicht mehr, erinnere mich aber klar an meine Kalkulation: Gelingt es mir, jeden der verbleibenden drei „Zehner“ ein paar Minuten unter einer Stunde zu laufen, sind die neun Stunden noch immer möglich! Unfassbar, und das trotz des Geschleiches über den Damm. Das baut auf! Weiter gedacht: Ich bin nicht erschöpft, unglaublich aber wahr. Gleich überschreite ich meinen „Rubikon“, die weiteste je von mir gelaufene Strecke: 70,568 Kilometer, letztes Jahr in Troisdorf. Und ich bin noch frischer, als ich es in meinen kühnsten Träumen zu hoffen gewagt hätte. ‚Ich werde nicht nur ankommen, es wird eine gute Zeit werden, sehr deutlich unter 10 Stunden! Selbst wenn ich ab jetzt abschnittsweise ginge, käme ich unter 10 Stunden ein!’ Am Ende dieser erfreulichen Gedankenstafette laufe ich schneller, ganz automatisch, kein Entschluss war nötig. ‚Wenn’s noch eine Chance auf unter neun Stunden gibt, dann will ich sie nicht verschenken …’
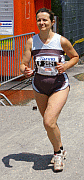
Auch an eine versuchte Kontrolle meines Laufstils erinnere ich mich nach dieser Stelle. Was ich im Schein meiner Lampe erkenne, im übrigen fühle, bietet allerdings keine verlässlichen Anhaltspunkte. ‚Es wird schon passen’ denke ich und gebe den Versuch rasch auf. Eine weitere Ansiedlung liegt im Laufweg. Von weiter vorne vernehme ich starken Lärm aus vielen Kehlen. Klingt ein wenig nach La-Ola-Welle, sehr laut auf jeden Fall. Ein paar Jugendliche haben sich dort niedergelassen. Was sie schreien verstehe ich nicht. Möglicherweise kann auch keiner der anderen, des Schwyzer Dütsch mächtigen Läufer, die kehligen, gelallten Formeln entschlüsseln. Sturzbesoffen gröhlen sie hinterher. Auf solches Publikum kann man getrost verzichten. Noch lange, bereits im angrenzenden Wald und dahinter laufend, höre ich wie sich das Schauspiel gereizter Trunkenheit mehrfach wiederholt. Die Nacht hat ihm keine anderen Geräusche entgegen zu setzen.
Die Nacht? Morgendämmerung hat endlich eingesetzt. Noch zu wenig Licht, um wirklich etwas zu erkennen, aber genug um meine Stimmung weiter aufzuhellen. Eine Viertelstunde später schalte ich die Lampe aus, ein geradezu feierlicher Akt. Links düsterer Wald, rechts modelliert die Dämmerung Wiesen, die in einer Niederung auslaufen, dahinter ein Hügelzug. Willkommen neuer Tag! Ein Stück weit voraus sehe ich Läufer, langsam in sanfter Steigung trabend. Eine Straßengabelung, die Markierung schickt uns nach rechts, das Verkehrsschild kündigt den Ort „Bibern“ in ein paar Kilometern an. Ich überhole einen der Läufer, dann noch einen. Ich kann wieder sehen, was für ein Geschenk. Und doch stimmt etwas mit meinem linken Auge nicht. Kneife ich das rechte zu, verschwimmen Straße und Landschaft. Es beunruhigt mich nicht, weil ich es kenne. Auch in Troisdorf trübte sich die Linse meines linken Auges in der Schlussphase ein, was sich jedoch schon eine Stunde nach dem Finish von selbst klärte. So wird, so muss es heute auch wieder sein!
Dort vorne haben sich zwei gefunden. Jedenfalls laufen sie nebeneinander und unterhalten sich. Die schlanke, hochgewachsene Gestalt des Linken kenne ich. Der hat mich vor fast sieben Stunden „angemacht“, weil er über meine Haken zu stolpern drohte. Meine Einschätzung hochgewachsener, gut austrainiert wirkender Modellathleten täuschte wieder einmal. Den hätte ich mit deutlichem Abstand vor mir im Ziel erwartet und nun ziehe ich mühelos an beiden vorbei. Die plaudern angeregt und gut gelaunt. Nachdem ich vorbei bin, heften sie sich an meine Fersen. Eine Nacht Gehörschulung reicht, um das nicht per Rückwärtsblick bestätigen zu müssen. Der Abstand bleibt konstant. Kurz nacheinander erreichen wir den letzten Kontrollpunkt in Bibern. Auch hier kann man den Wettkampf mit Wertung beenden. „Pfüüüt“ grüßt die Matte und ich schere zum Getränkestand aus, spiele wieder mal ein bisschen Talsperre …
Offiziell: 76,1 km, 7:00:00 (steht so auf der Urkunde, kein Scherz), Platz 66, nun allerdings infolge Dammverzögerung 9 Minuten über dem Schnitt für eine Zeit Sub9h.
Weiter! Von hinten vernehme ich gleich wieder das „Tapp-Tapp-Tapp“ des Verfolger-Tandems. Halblaut tauschen sie sich aus. Ohne zu verstehen, weiß ich worüber sie reden, denn dasselbe beeindruckt mich auch. Das Streckenprofil drohte hinter Bibern mit einer letzten, heftigen Steigung. Ich spüre den Hügel, muss das Tempo merklich reduzieren. Dennoch nehme ich ihn immer noch „locker“. Nicht mit Leichtigkeit, nein, aber auch ohne nennenswertes Problem. Ich schaue talwärts. So weit der Blick reicht wechseln sich Wald und Wiesen ab. Aus nacht- und regenfeuchten Niederungen steigen Morgennebel. Petrus hat vorzeiten die Schleusen geschlossen, sieht aus, als gönnte er uns ein trockenes Finish. Schrittgeräusche werden leiser, das Gespräch verstummt schon eher. Das Duo kann nicht mehr folgen. Ich registriere es mit Befriedigung und lasse mich davon beflügeln. Mein Selbstvertrauen hat längst wieder den gewohnten Pegel erreicht. Mehr als zwanzig Kilometer vor dem Ziel schießt er mir bereits durch den Kopf, ein Gedanke, der sich sonst erst kurz vor Schluss einstellt: „Es wird klappen! Nichts kann mich jetzt mehr aufhalten!“ Vermessen oder nicht, auch diese Formel treibt mich an. Also lasse ich sie zu. Tageslicht und ausbleibende Erschöpfung in forderndem Anstieg bilden die Hauptgründe für diese Frechheit. Man mag daran auch ablesen, in welch üblem Tief mich die Nacht zuvor gefangen setzte ...
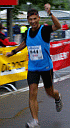
Der Scheitel ist erreicht, meine Schrittfrequenz steigt. Das Streckenprofil verspricht nun heftiges Gefälle. Das wird weh tun, aber mein Vorsatz steht unverrückbar: So schnell wie möglich runter, Zeit aufholen, Schmerz ignorieren! Und exakt so zieh ich das durch. Der Gewaltakt gegen den eigenen Körper fällt zu meiner neuerlichen Überraschung erträglich aus, die Beine jaulen nur verhalten. Zwei Läufer voraus, im Abstand von je hundert Metern, fachen meinen Kampfgeist weiter an. Mit langen, flüssigen Schritten geht es abwärts. Den hinteren Läufer samt Radbegleitung hole ich schnell ein, zu sehr zügelt der sein Tempo. Vorbei und weiter. Ein heftiger Ritt über drei Kilometer Gefälle rüttelt alle Knochen durch. Egal, muss Zeit aufholen, Zeit, die mir der Damm gestohlen hat. Der zweite Läufer ist nur wenig langsamer unterwegs als ich. Inzwischen bleibt der Wald zurück, ein weites Flusstal und die nächste Ortschaft erfasst mein linksseitig trüber Blick. Eine Tafel leistet weitere Schützenhilfe: „80 Km“ - nur noch zwanzig Kilometer, nur noch 20, weniger als ein Halbmarathon! Die ersten Häuser von Arch, noch immer abschüssig, noch immer schnelle Pace. Mitten durch den Ort, Feuerwehr sperrt ab, die Hauptstraße kreuzend und runter. Sanfter jetzt, aber immer noch runter. Zum Trinken stoppe ich so kurz wie möglich. Weiter, weiter ... Eine Unterführung beendet schließlich die Schussfahrt. Kurz dahinter holt mich ein Streckenposten vom asphaltierten Radweg, Kurs Aare. Auf den ersten Metern Feldweg überhole ich den zweiten Läufer. Oder verweilte der am Getränkestand und dies ist ein anderer?
Genauso hab ich mir das vorgestellt: Der recht schmale Weg schmiegt sich eng an die sanften Biegungen des Flusses und fordert weiteren Tribut. Manche Pfützen sind nur über den grasigen Rand oder halb durch Büsche trockenen Fußes zu überwinden. Ab und an fehlt auch diese Möglichkeit, dann musst du einmal mitten rein tappen und das Beste hoffen. Das Beste bedeutet aber immer noch nasse Füße. ‚Das ist mir jetzt total wurscht!’ Ich denke schnodderig „wurscht“, nicht korrekt hochdeutsch „egal“. Das unterstreicht den im Satz enthaltenen Trotz. Nichts kann mich jetzt mehr aufhalten! Eine Weile gehört die herrliche, frühmorgendliche Flusslandschaft mir alleine. Hauptsächlich übe ich die neue Sportart „Pfützenspringen“, daneben bleibt aber ausreichend Muße den Anblick der Aare zu genießen. Ruhig und träge zieht sie dahin, ab und an liegen ein paar Kähne oder Boote sicher vertäut am Ufer. Wo bleibt eigentlich die Sonne? Eine Zeit lang sah es so aus, als ginge sie bald über dem Höhenzug in meinem Rücken auf. Stattdessen tröpfelt es nun. Der Himmel möge sich mit einem kleinen Schauer begnügen lautet meine Hoffnung. Angesichts der finster, fett und drohend aufziehenden Wolkenwalze links querab ein recht frommer Wunsch. Ein Stück weit voraus, wenn Wegkurven und üppiges Grün es zulassen, mache ich den nächsten Läufer aus. Ein neues Zwischenziel! Das anfängliche Tröpfeln darf sich jetzt wahrhaft „Regen“ nennen. Im Nu bin ich klatschnass. ‚Sch... drauf! Lauf! Lauf!“ Ein kleiner Nachbrenner wird mir geschenkt: „85 Km“. ‚Nur noch 15, nur noch 15, nur noch 15 ...’

Die Distanz zu Herrn „Weinrot“ verkürzt sich, immer häufiger und größer taucht der Farbklecks vor mir auf. Wo liegt die Grenze zwischen Schauer und Landregen? Es kommt mir länger vor, goss aber sicher nicht länger als eine Viertelstunde, höchstens zwanzig Minuten. Mr. „Weinrot“ ist überholt und dort vorne zwischen Bäumen erwartet mich ein Städtchen. Scharf abgegrenzt geht der Pfützenpfad in einen asphaltierten Spazierweg über. Ok, asphaltiert isser, trotzdem eine holprige Stolperfalle, also Vorsicht! Eine ähnlich attraktive Holzbrücke, wie jene gestern Abend in Aarberg, hat der Ort zu bieten. Am Verpflegungspunkt gönne ich mir noch ein bisschen Energie, schütte mich aber nicht mehr so voll wie in der Nacht. Ich durchquere das Städtchen (Büren an der Aare) größtenteils entlang des Flusses, bis uns eine Brücke ans andere Ufer bringt. Ans andere Ufer und wenig später vor eine Fußgängerbrücke über einen Altwasserarm der Aare. Mit Schwung will ich über die Holzplanken des zur Mitte hin aufgewölbten Bauwerks rennen. Das reagiert auf Art flexibler Fußgängerbrücken seinerseits mit „Schwung“. Nach ein paar Schritten hat es sich auf meinen Laufrhythmus eingeschwungen und verpasst mir bei jedem Aufsetzen der Füße einen unangenehmen Stoß. Und drüber. Durch ein Wohngebiet zurück zum Fluss, von diesem getrennt durch eine dichte Reihe von Bäumen und Büschen. Das Geläuf ist nicht ideal, aber brauchbar, Pfützen bilden eher die Ausnahme. Schwarzer Läufer mit Radbegleitung voraus. Halt, genauer hinsehen, es ist eine Läuferin. Ich ziehe meinen virtuellen Hut, als ich wenig später an der Dame in Schwarz vorbei ziehe (Sie wird als drittplatzierte Frau ins Ziel kommen).
Ein im Grunde absurder Widerstreit entspinnt sich seit einer Weile in meinem Kopf. Soll ich das Tempo ein wenig verschärfen? Was und wie ich im Moment laufe kommt mir - finde ich jetzt die passenden Worte? - zu „einfach“ vor. Müsste ich jetzt nicht eigentlich elend leiden? Es gipfelt in dem unheroischen Verdacht bis zu dieser Stelle vielleicht nicht wirklich alles gegeben zu haben. Das 90 Km-Schild kommt genau im richtigen Moment, um mir einen Entschluss abzunehmen. Die Uhr zeigt 8:10:xx. ‚Wenn ich die letzten zehn Kilometer im 5er-Schnitt laufe, könnte ich noch knapp unter 9h ankommen!’ Diese Absicht mag weniger aktiven Läufern als der Gipfel des Hochmuts vorkommen. Dabei ist sie nur Ausdruck wieder erstarkten Ehrgeizes, es doch noch packen zu wollen. Und das nach 90 Kilometern unfassbar gute Laufgefühl tut ein übriges. Also mach’ ich es, beschleunige meine Schritte ...
Es geht, ich bringe es noch. Das ist ein ganz und gar merkwürdiger Lauf. So kurz vor dem Ende rannte ich in Troisdorf längst im „Tunnel“ eingeschränkter äußerer Wahrnehmung, war fix und fertig, stampfte roboterhaft durch die Gegend. Nichts dergleichen heute: Ich sehe, höre, rieche alles und bin guter Dinge. Eine Markierung zeigt nach rechts, weg vom
 Fluss. Über niedrig bewachsene Felder blickend, erkenne ich Oberkörper und Hüfte weiterer Läufer, nähere mich zügig. Noch mal rechts, dann wieder links, einen überholt. Dann erhält mein anspruchsvoller Zeitplan den endgültigen Todesstoß - ich weiß das sofort, ein Blick genügt. Mit einer Steigung habe ich nicht mehr gerechnet. Später werde ich sie fotografieren, sie wird mir lächerlich flach vorkommen. Aber jetzt „zerlegt“ sie mich. Unbelehrbar, stur am allerletzten, törichten Hoffnungsschimmer festhaltend, versuche ich mein Tempo zu konservieren. Binnen Sekunden werden die Beine tonnenschwer, lassen mich merken, wie nah das Ende ist. Ich krieche den Feldweg hoch, füge mich. Aber Gehen kommt nicht in Frage! Verhaltenes Traben erlauben die versiegenden Kräfte noch! Von diesem Einbruch erhole ich mich nicht mehr. Als die Route abflacht hab ich nichts mehr zuzusetzen. ‚Wenigstens bin ich jetzt sicher alles gegeben zu haben’ denke ich mir die Situation ein bisschen schöner.
Fluss. Über niedrig bewachsene Felder blickend, erkenne ich Oberkörper und Hüfte weiterer Läufer, nähere mich zügig. Noch mal rechts, dann wieder links, einen überholt. Dann erhält mein anspruchsvoller Zeitplan den endgültigen Todesstoß - ich weiß das sofort, ein Blick genügt. Mit einer Steigung habe ich nicht mehr gerechnet. Später werde ich sie fotografieren, sie wird mir lächerlich flach vorkommen. Aber jetzt „zerlegt“ sie mich. Unbelehrbar, stur am allerletzten, törichten Hoffnungsschimmer festhaltend, versuche ich mein Tempo zu konservieren. Binnen Sekunden werden die Beine tonnenschwer, lassen mich merken, wie nah das Ende ist. Ich krieche den Feldweg hoch, füge mich. Aber Gehen kommt nicht in Frage! Verhaltenes Traben erlauben die versiegenden Kräfte noch! Von diesem Einbruch erhole ich mich nicht mehr. Als die Route abflacht hab ich nichts mehr zuzusetzen. ‚Wenigstens bin ich jetzt sicher alles gegeben zu haben’ denke ich mir die Situation ein bisschen schöner.
Noch einmal runter, darf noch mal ein wenig schneller laufen. Vor kleinem Ort ein Mensch mit Kamera, erst „Klick“ in meine Richtung, dann „Klick“ in die Landschaft, wozu, warum, weiß nicht, egal, egal ... Durch den verlassenen Ortsrand, Betriebsgelände voraus, rein (‚Bin ich auf Kurs?’), dann links, dort vorne ein Verpflegungspunkt. Nein, jetzt nur nicht mehr stehen bleiben. Weiter, weiter ... Dorf verlassen, nach halblinks und wieder aufwärts. Vor mir ein Läufer, den sehe ich schon eine Weile. Keine Kraft mehr den Abstand zu verkürzen. Wieder leicht bergan, jetzt ist es hart, verdammt hart. Autobahn parallel zum Laufweg, dichter Verkehr rauscht herüber. Dazwischen die Bahnlinie. Jetzt rauscht’s stärker, ein Zug zischt von hinten heran, ist vorbei ... Der Traubenzucker fällt mir ein. Hab ich ihn nicht genau für diesen Fall mitgenommen? Aber es ist noch zu früh. Der davon ausgehende Schub, falls es ihn geben sollte, hält nicht lange und ich fürchte danach in ein noch tieferes Leistungsloch zu fallen. Noch warten!
„95 Km“ - ab jetzt also jeden Kilometer eine Tafel. Weiter, wieder durch Wald, bald leicht aufwärts, dann wieder abschüssig. Hat diese Berg- und Talfahrt noch mal sein müssen? „96 Km“ - ich nestele die quadratische Traubenzuckerportion aus meiner Handgelenktasche. Folienumhüllung ab und rein in den Mund. ‚Oh Mann, ist das Ding trocken!’ Der Zucker will sich partout nicht auflösen. ‚Hilft nix, muss es zerkauen!’ Ich beiße zu und dann passiert’s. Eines der Bröckchen oder nur vom feinen Zuckerstaub muss ich eingeatmet haben, komme augenblicklich unter brachialem Hustenanfall zum Stehen. Den ergänzt heftiges Würgen, der Magen versucht durch die Speiseröhre ein wenig Licht zu erhaschen. Zum Erbrechen fehlt Substanz, der Würgereiz lässt schnell nach, der Husten nur zögerlich. War’s das jetzt mit den 100 Km von Biel? Ein, zwei Läufer traben vorbei. Keiner kümmert sich um mich, kann’s verstehen, die sind einfach zu fertig und Husten ist ja ein klares Lebenszeichen. Dann flaut die Attacke ab, der Spuk ist vorbei. Ich atme gleichmäßig und versuche anzutraben. Es geht! Gott sei Dank geht es noch! ‚Also doch nur was in den falschen Hals gekriegt.’ Und ich dachte schon ... Weiter, weiter jetzt, gleich ist es geschafft.
„97 Km“ - Tempo wieder passabel, hab mich vom Hustenhorror erholt. Alles paletti. Ein wenig freue ich mich auf das 99er-Schild. Wie oft kriegt ein Läufer so eine irre Markierung zu sehen - „Neunundneunzig Kilometer“?. Der nächste Zug rauscht vorbei, Autos sowieso. „98 Km“ - zum wiederholten Male berechne ich die Ankunft, multipliziere die Restkilometer vorsichtshalber mit 7 min. Unter 9:10h könnte klappen. Ich kann einfach nicht aus meiner Haut. Die Hoffnung stirbt zuletzt sagt man, oh ja, der Ehrgeiz aber auch ... Unter 9:10h ist jetzt Wunsch und Verpflichtung. Ich backe kleinere Brötchen, aber nur minimal kleiner. Lauf! Lauf, keine zwei Kilometer mehr! Der Weg mündet in eine Straße, leicht
abschüssig, Zugtrasse und Autobahn werden unterquert. Wieder etwas schneller auf ein Betriebsgelände, den mit großem
Abstand hässlichsten Teil der Strecke: Links voraus ein riesiger Dreckhaufen, in Laufrichtung ein weiterer - wirklich
 scheußlich. Dann sehe ich ein Schild, das muss es sein - „99 Km“. Eine Läuferin biegt davor links ab, der Weg scheint mir logisch. Isser aber nicht, denn sie dreht kurze Zeit später um und erspart mir so einen Umweg. Weiter, weiter, noch ein Kilometer! Die Uhr zeigt 9:02:xx. Es wird eng, aber es wird klappen. Noch einmal lege ich verbliebene Kraft in den Lauf, sehe in der Ferne schon das Eisstadion. Es wächst, nach jedem Schritt baut es sich größer auf. Keine 500 Meter mehr, gleich geschafft! Bin müde, ausgepowert, aber nicht am Ende, laufe kontrolliert. Die Beine tragen, gehorchen noch, kaum zu glauben. Bin am Eisstadion, erste Zuschauer applaudieren, noch eine Kurve, nehme sie mit nicht mehr erwarteter Leichtigkeit, spüre den Triumph in mir, die Freude ... Zielgerade, noch 30 Meter. Da ist Ines! Fotografiert! Recke die Faust siegesgewiss in den Himmel, lache sie an. Letzte Meter zum Ziel, bin im Ziel, könnte schreien vor Freude und schreie ...
scheußlich. Dann sehe ich ein Schild, das muss es sein - „99 Km“. Eine Läuferin biegt davor links ab, der Weg scheint mir logisch. Isser aber nicht, denn sie dreht kurze Zeit später um und erspart mir so einen Umweg. Weiter, weiter, noch ein Kilometer! Die Uhr zeigt 9:02:xx. Es wird eng, aber es wird klappen. Noch einmal lege ich verbliebene Kraft in den Lauf, sehe in der Ferne schon das Eisstadion. Es wächst, nach jedem Schritt baut es sich größer auf. Keine 500 Meter mehr, gleich geschafft! Bin müde, ausgepowert, aber nicht am Ende, laufe kontrolliert. Die Beine tragen, gehorchen noch, kaum zu glauben. Bin am Eisstadion, erste Zuschauer applaudieren, noch eine Kurve, nehme sie mit nicht mehr erwarteter Leichtigkeit, spüre den Triumph in mir, die Freude ... Zielgerade, noch 30 Meter. Da ist Ines! Fotografiert! Recke die Faust siegesgewiss in den Himmel, lache sie an. Letzte Meter zum Ziel, bin im Ziel, könnte schreien vor Freude und schreie ...
Medaille umgehängt, Ines bei mir, umarmt den glitschigen Kerl, der für Sekunden die Fassung verliert ... Dürfen Männer weinen? Ja, dürfen sie und nach 100 gelaufenen Kilometern und vor Glück erst recht. - Da ist Stefan! Was tut der hier? Ich begreife und empfinde sofort intensives Bedauern. Er musste abbrechen. Von Beginn an lief es nicht und er quälte sich noch bis Kirchberg. Ich „gratuliere“ ihm zu seinem Entschluss, dort ausgestiegen zu sein, denn nach Kirchberg beginnt der Damm ...
Offiziell: 100 Kilometer, 9:07:42, Platz 57 von 1118 Finishern, in meiner Altersklasse Platz 6 von 156 Finishern.
Mein sportliches Ziel habe ich erreicht. Insbesondere die Platzierung gibt Auskunft über die erbrachte Leistung. Bedenkt man die Umstände, allen voran den Emmendamm, der mich rund zehn Minuten kostete, werten sie die Laufzeit zusätzlich auf. Ich freue mich sehr über diesen Erfolg. Aber Laufen bedeutet mir mehr, als am Tag X eine über Monate vorbereitete Leistung tatsächlich abzuliefern. Ich laufe vor allem auch des schönen Erlebnisses wegen. Und diese Freude verbindet sich eben nur zum Teil mit guten Laufleistungen. Erleben heißt für mich laufend sehen, Eindrücke sammeln, auch genießen, sich über weite Strecken wohlfühlen, alleine und mit anderen. In diesem Sinne war Biel alles andere als eine Sternstunde meiner Laufserie. Der Lauf sah mich in ungeahntem Stimmungstief. Stundenlange Dunkelheit ist nicht mein Fall. Auch unfallträchtige Strecken meide ich nach Möglichkeit. Um auf dem Emmendamm unter den vorgefundenen Bedingungen nicht zu stürzen, braucht man Glück. Ich hatte es. Dort langsamer zu laufen oder zu gehen entspräche der Vernunft. Aber Wettkampfgeschehen oder Leistungsorientierung gibt es nicht ohne Ehrgeiz und der ist nun mal mit Sicherheitsdenken schwerlich in Einklang zu bringen. - 100 Kilometer laufen? Jederzeit wieder, aber nicht in der Nacht und nicht in Biel.
In den Tagen nach Biel schaue ich zurück, erinnere mich an all die schönen Trainingsmarathons, an wundervolle Stunden mit netten Laufbekannten, in interessanten Städten und aufregender Natur. Wenn man auf ein großes Ziel hinarbeitet, ihm vieles unterordnet und zahlreiche Opfer bringt, unterliegt man leicht dem Eindruck alle Mühen wären für sich genommen wertlos, fänden ihren Sinn nur im finalen Erfolg. Da mich der „Geist von Biel“ nicht berührte und die „Nacht der Nächte“ misslang, bin ich glücklich es ganz anders zu empfinden. Ich unternahm eben nicht nur „alles für eine Nacht“!
Ines beim „Büttenberglauf“

Sie schwankte lange, ob sie am Samstag nach meinem 100 km-Finish noch selbst laufen solle. Die Lauflust obsiegte und so meldete sie sich Freitagabend nach. Start war um 14:30 Uhr. Das Schauerwetter war zwischenzeitlich konstantem Sonnenschein und warmem Vorsommerwetter gewichen. Immerhin waren 14,5 Kilometer zu bewältigen und Ines hatte in den Wochen zuvor „nur“ nach Lust und Laune trainiert. Entsprechend zurückhaltend ließ sie es angehen. Genuss und Erlebnis standen im Mittelpunkt. Als ich sie nach 1:29:08 im Ziel erwartete, lief sie mir mit einem glücklichen Lächeln vor die Kamera. Wundervolle Landschaften und herrliche, alte Bauerhöfe hatte sie auf ihrem Weg gesehen. Leicht war der Kurs nicht, etwa 100 Meter Anstieg waren zu bewältigen. Sie nahm ihn mit Bravour, brauchte nicht mal gehen, wie manch anderer.
Ich verbrachte die Zeit mit Fotografieren und genoss auch eine halbe Stunde (!) Massage. Am Nachmittag gab’s keine Wartezeiten und die Masseure ließen sich alle Zeit der Welt. Super! Für uns beide ein schöner Ausklang der Bieler Lauftage ...
Biel - die Manöverkritik
Wenn ich im folgenden negative Kritik übe, soll darüber nicht vergessen werden, dass vieles exzellent vorbereitet und durchgeführt war. Insbesondere das vorab per Post übersandte Infopaket oder die reichhaltig ausgestatteten Verpflegungsstände verdienen Erwähnung. Andererseits darf man das bei einem Ultralauf über 100 Km und einem erklecklichen Startgeld von € 65,- auch erwarten. Einige Umstände lassen mir den „Mythos Biel“ allerdings als verklärte Vorstellung glückstrunkener Finisher erscheinen. Immerhin nimmt man dort für sich in Anspruch, die „Nacht der Nächte“ vorzubereiten und beschwört den „Geist von Biel“. Also lege ich das als Messlatte an. Dem widersprechen ein paar wichtige Details, für sich genommen leichtgewichtig, in der Summe störend. Die Realität rechtfertigt von einer soliden, insgesamt gelungenen Laufveranstaltung zu sprechen. Fragezeichen setze ich hinter folgende Punkte:
- Der Veranstalter hat kein Parkkonzept. Er verschickt Parkkarten, ohne jeden Hinweis zu deren Gebrauch und Nutzen. Vor Ort gibt es de facto keine Parkplätze. Folge: Wildes Parken und Angst vor dem Abschleppwagen. Wer das vermeiden will, sollte auf jeden Fall mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen.
- Ein Transport von Wechsellaufbekleidung nach Km 55 war angeboten und fand statt. Bei Km 55 war dann nicht zu erkennen, wo man den Kleiderbeutel erhalten und sich umziehen kann. Erst danach fragen zu müssen, wirkt reichlich dilettantisch.
- Die Zeitmessung erfolgte mit dem Champion-Chip. Eigene Chips waren nicht zugelassen, obwohl ein Großteil der Teilnehmer darüber sicher verfügt. Weshalb folgen die Bieler nicht dem Beispiel anderer Veranstalter, lassen den Individual-Chip zu und reduzieren dafür die Startgebühr? Denn exakt deshalb kaufen Läufer ihren Chip!
- Im Ziel nach - in Worten - einhundert Kilometern, gab es keine feste Kost! Nicht mal einen Apfel oder eine Banane. Lediglich Elektrolyte waren verfügbar. Wer etwas essen wollte, musste sich zunächst in den Besitz seines Portemonnaies bringen und konnte dann im Festzelt einkaufen. Fette Pommes, Bratwürste, Kuchen, usw. Läufernahrung zur Erstversorgung? Fehlanzeige! Das ist ein Armutszeugnis und nicht tolerabel. Nehmt mir halt einen Euro Startgebühr mehr ab und drückt mir Bitteschön im Ziel eine Banane in die Hand ... Ansonsten riecht das verdammt nach Einnahmenmaximierung.
- Die Zuschauerresonanz entsprach am wenigsten der von schwärmerischen Erzählungen geschürten Erwartung. Wirklich dichte Zuschauerränge gab’s da, wo man sie am wenigsten braucht: Am Start, im abendlichen Biel, nach ca. 18 km in Aarberg. Mach dir keine Illusionen: Danach bist du mit den anderen Läufern zu 98% alleine. Ob sich dies für Läufer, die am späteren Vormittag noch auf der Strecke sind, ändert, kann ich nicht sagen.
- Auf dem Emmendamm steigt nachts und insbesondere nach vorangegangenen Regenfällen die Unfallgefahr (= Ohne Stirnlampe kein Biel!!!). Ich kann nur jedem empfehlen meinem Beispiel nicht zu folgen und dort zu gehen oder höchstens langsam zu traben.
Mein 100 Km-Trainingsplan